
Schmetterlinge entdecken & fördern

2024 widmet sich „Natur im Garten“ unter anderem den Schmetterlingen - denn diese sind nicht nur schön anzusehen, sie sind auch wichtige Bestäuber, die es zu schützen gilt. Schmetterlinge sind mit ihrer Farbenpracht und Zartheit wunderschöne, bezaubernde Geschöpfe und zählen wohl zu den hübschesten Gartenbesuchern unserer heimischen Tierwelt. Sie haben von der Raupe bis hin zum Falter eine hohe und sehr breite ökologische Bedeutung und spielen für das Ökosystem, in dem sie leben, eine enorm wichtige Rolle. Von den über 4.000 Schmetterlingsarten in Österreich gilt mehr als die Hälfte als gefährdet.
Zerynthia polyxena ist der zoologische Name des Osterluzeifalter, welcher ebenso wie z.B. der vielen bekannte Schwalbenschwanz zur Familie der Ritterfalter (Papilionidae) gehört. Typisch für einen Ritterfalter, ist der Osterluzeifalter ein sehr hübsche Tagfalterart. Die Flügelspannweite beträgt durchschnittlich 5,5 cm - auffällig ist die unverwechselbare Flügelzeichnung. Der Grundton der Flügel ist gelblich, der Flügelrand wird kontrastreich von einem schwarzen Wellen-/Zackenmuster geziert. Die Oberseite der Hinterflügel zeigt runde, rote und teils blaue Ornamente. Auch die Flügelunterseite ist mit einem auffälligen schwarzen Binden- und Zackenmuster und roten Zacken und Punkten akzentuiert. In Österreich flattert die Schönheit, je nach Temperatur und Wetterlage, zwischen März und Ende Juni umher.
Der Name des Falters ist Programm, denn seine einzige Raupenfutterpflanze in Österreich ist die Gewöhnliche bzw. Aufrechte Osterluzei (Aristolochia clematitis). Diese für Österreich gesamt betrachtet seltene Pflanzenart findet sich vor allem in lichten Auwäldern mit Wiesen und Trockenrasen sowie an sonnigen Hängen mit Gebüschen, wärmebegünstigten Randbereichen an Dämmen und Böschungen, Bächen, Flüssen, Gräben, Kanälen, Straßen- und Wegrändern, Bahnlinien und (aufgelassenen) Weingärten. An geeigneten Standorten kann der Bestand der Pflanze dann durchaus üppig sein. Und wo die Osterluzei gedeiht, ist auch der wunderschöne Falter meist nicht weit…
Warum ist der Osterluzeifalter nun eine seltene Schönheit des Ostens?
Der Falter kommt in Österreich nur in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark vor – eben dort wo auch die Raupenfutterpflanzen wachsen. Aufgrund der ausgeprägten Abhängigkeit von der Raupenfutterpflanze und der kurzen Lebensdauer der erwachsenen Tiere (durchschnittlich 4 bis 6 Tage) gilt die Schmetterlingsart nach aktuellen Erkenntnissen als sehr standorttreu.
Der Osterluzeifalter gilt in Niederösterreich und Wien als stark gefährdet, im Burgenland und der Steiermark als vom Aussterben bedroht und ist laut EU-Richtlinie streng geschützt. Das Gesamtverbreitungsgebiet dieser Schmetterlingsart erstreckt sich von Südfrankreich und Norditalien über den Balkan hinweg bis nach Südwestrussland. Die aktuelle Nordgrenze des natürlichen Vorkommens reicht in Mitteleuropa bis ins südliche Tschechien, womit Österreich als Randposten eine wichtige Position im Ausbreitungsareal des Osterluzeifalters in Europa einnimmt.
Osterluzeifalter-Raupen: ausgesprochene Gourmets
In der Fachsprache wird die Spezialisierung auf eine einzige Nahrungspflanze als Monophagie (aus dem Griechischen ‚monos‘ - einzig/allein und ‚phagein‘ - fressen) bezeichnet. Die Raupen müssen „ihr“ Osterluzei-Buffet so zwar nicht mit anderen Schmetterlingsarten teilen, doch dieser Vorteil ist auch ihre Achillesferse. Ohne geeignete Vorkommen der Futterpflanze, gibt es schlichtweg auch keinen Osterluzeifalter. Darüber hinaus sind die Falter-Mütter bei der Eiablage auch noch wählerisch: dichte Bestände mit hochwüchsigen Pflanzen, großen Blättern und reichem Blütenangebot in sonniger Lage werden zur Eiablage bevorzugt. Die „Immobiliensuche“ für die Kinder des Osterluzeifalters ist also wirklich nicht leicht. Wenn Österreich Heimat dieser seltenen Schönheiten bleiben soll, dann ist der Schutz der Gewöhnlichen Osterluzei an geeigneten Standorten für das Überleben des Falters unverzichtbar.
Ein Falterleben beginnt…
Nach der Paarung legt das Weibchen die winzigen, wie schimmernde, weiße Perlen aussehenden Eier einzeln oder in kleinen, losen Gruppen meist an der Blattunterseite der Osterluzei ab. Nach etwa einer Woche schlüpfen die kleinen Raupen, die zunächst schwarz gefärbt sind und gelbe Höcker mit Borsten tragen, direkt im Schlaraffenland. Sie wachsen in den folgenden 4 bis 5 Wochen bis zu einer Länge von 35 mm lang und verändern dabei ihr Aussehen. Je nach Entwicklungsstadium variiert die Farbe zunächst von hellbraun, gelblichweiß oder gelblichgrau mit schwarzen Punkten. Im fortgeschrittenen Stadium haben sie einen hellen Grundton mit sechs Reihen orangener, von Borsten besetzter Hautzapfen mit schwarzen Spitzen. Warum aber dieses skurrile Aussehen als Raupe und die auffällige Zeichnung des Falters – das müsste doch einem jeden Fressfeind sofort ins Auge stechen?
Gift-Räupchen - Fressen, um nicht gefressen zu werden
Zu Beginn ihres Lebens fressen die Räupchen vor allem an zarten Pflanzenteilen sowie an den Blüten der Osterluzei. Erst nach der zweiten Häutung wird auch gröberes Blattmaterial verspeist. Die Pflanze wehrt sich eigentlich mit Giftstoffen (Aristolochiasäuren) gegen das Gefressenwerden. Das beeindruckt die Osterluzei-Raupen überhaupt nicht, für Wirbeltiere – und damit übrigens auch für uns Menschen – ist die Pflanze aber sehr giftig. Die Raupen nehmen den Giftstoff während des Fressens auf und lagern ihn im Körper ein, damit ist später sogar auch der Falter „verseucht“. Diese Schmetterlingsart erhält also durch ihre Futterpflanze Superkräfte und zeigt ihren Wirbeltier-Widersachern auch ganz keck: Hey, lass mich lieber in Ruhe, ich bin giftig und mich zu fressen kann ganz schön übel für dich ausgehen! In der Fachsprache wird eine solch auffällige „Warnfärbung“, die potenziellen Fressfeinden Ungenießbarkeit bzw. Wehrhaftigkeit anzeigt, als Aposematismus bezeichnet. Die gegensätzliche Strategie dazu im Tierreich ist übrigens die Tarnung.
Vier bis fünf Wochen nach dem Schlupf verpuppen sich die Raupen an den Blattunterseiten der Osterluzei, aber auch an Zweigen oder anderen pflanzlichen Strukturen oder sogar an Steinen in der nahen Umgebung der Raupenfutterpflanze. Raupen kann man daher nur etwa bis Anfang Juli beobachten. In Form einer gut getarnten, bräunlichen/gelb-grauen Gürtelpuppe ruhen sie dann etwa 10 Monate bis zum Schlupf. Je nach Temperatur und Wetterlage sind dann wieder die Falter zwischen März und Ende Juni unterwegs. Da sich bei dieser Schmetterlingsart nur eine Generation pro Jahr entwickelt, wirkt sich die nicht fachgerechte Mahd von Raupenfutterpflanzen besonders fatal aus. Wird die Osterluzei mit den Eiern bzw. Raupen entfernt oder nahe der Futterpflanze wachsende Strauchgruppen mit dort ruhenden Puppen geschnitten, dann fällt der Nachwuchs in diesem Jahr vollständig aus. Solches Wissen ist im Hinblick auf Schutzmaßnahmen für den seltenen Falter sehr wichtig.
Über die Nahrung der erwachsenen Falter in Österreich ist kaum etwas bekannt. Die Osterluzei ist eine Pflanze mit sehr speziellen Blüten und bietet den Schmetterlingen sicherlich keinen Nektar. In der Fachliteratur beschriebene Beobachtungen dokumentieren, dass die im Durchschnitt nur etwa 4 bis 6 Tage lebenden Falter keine Nahrung zu sich nehmen, obwohl sie anatomisch dazu in der Lage wären. (Es gibt nämlich auch Schmetterlingsarten, die als Falter gar keine Nahrung aufnehmen können. Dazu zählt z.B. das Wiener Nachtpfauenauge, die Handflächen groß ist und damit als größte Nachtfalterart Europas gilt. Sie hat im Falterstadium gar keine funktionsfähigen Mundwerkzeuge und kann deshalb auch nichts fressen.). Wer also Osterluzeifalter fördern will, der muss vor allem den Raupen bieten, was ihr Herz begehrt.
Jede Menge Osterluzeien für den Osterluzei-Falter
Für das Überleben des Osterluzeifalters ist die Förderung der Aufrechten Osterluzei das Um und Auf.
- Sollten Mäharbeiten im Gemeindebereich unumgänglich sein, so sollten sie erst nach der Verpuppung stattfinden („Für Wien ist eine Mahd von Osterluzei-Beständen daher ab Ende Juli möglich, sofern es sich um Saumbereiche von offen zu haltendem Grasland handelt.“ Masterarbeit Stefanie Jirout, BEd; 2021; Universität Wien).
- Wesentlich sinnvoller ist der Schutz vorhandener Bestände durch zum Beispiel das Aussparen sonnig stehender Osterluzeien bei Mäharbeiten, möglich sind auch gezielte Pflanzungen. In mancher Staudengärtnerei findet sich Aristolochia clematitis zum Kauf als Gartenpflanze. Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass die Wirtspflanzen im Sinn eines entsprechenden Besiedelungserfolgs des Falters in ausreichender Anzahl vorhanden sein, über reichlich Blätter und Blüten verfügen und sonnig bis halbschattig (Süd/Süd-Ost Ausrichtung) stehen sollten. Damit die Pflanzung also für den Osterluzeifalter auch sinnvoll ist, muss sie eine gewisse Bestandsgröße und Lage sowie eine fortgeschrittenen Entwicklungsstadium der Pflanzen aufweisen. Die obig genannte Studie (Masterarbeit Stefanie Jirout, BEd; 2021; Universität Wien) gibt z.B. eine Mindestgröße von 10 m2 Pflanzenbestand für den Großraum Wien an. In solchen neu gepflanzten, geeigneten Beständen können Osterluzeifalter-Raupen durch Nachzucht von Spezialistinnen und Spezialisten auch gezielt wieder angesiedelt werden. Damit sich eine Population aber auch langfristig halten kann, braucht es mehrere, nahe beieinander liegende „Inseln“ von solchen geeigneten Osterluzeibeständen.
- Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sollte in der nahen Umgebung von Raupenfutterpflanzen selbstverständlich unbedingt vermieden werden.
- Wichtig ist außerdem, dass etablierte Osterluzei-Bestände nicht „unnatürlich“ rasch von der benachbarten Vegetation überwachsen werden. Insbesondere invasive Neophyten, wie etwa die Riesen-Goldrute (Solidago gigantea) oder das Indische Springkraut (Impatiens glandulifera), können solide Osterluzei-Bestände nämlich rasch verdrängen. Gezieltes Neophyten-Management (jährlich zwei- bis dreimalige Mahd) zählt deshalb ebenso zu einer wichtigen Maßnahme zur Bestandssicherung vorhandener Vorkommen der Aufrechten Osterluzei.
- Regelmäßige Überprüfung und Erhebungen der Situation des Osterluzeifalters und seiner Raupenfutterpflanze runden das Schutzpaket für den wunderschönen Falter ab. Hier seid ihr gefragt: werdet ein Teil der größten Schmetterlings-Familie Österreichs und helft mit, gemeinsam wertvolles Wissen über unsere heimische Faltervielfalt zu sammeln: www.schmetterlingsapp.at
Spannende Anekdoten: Ein Ausflug in den Süden – Wo Osterluzei nicht gleich Osterluzei ist
Es geht bei der Spezialisierung des Osterluzeifalters in Bezug auf seine Raupenfutterpflanze sogar noch spezieller als speziell. In Oberitalien (Piemont) gibt es drei unterschiedliche Osterluzei-Arten: die auch in Österreich wachsende Gewöhnliche Osterluzei (Aristolochia clematitis), die Rundknollige Osterluzei (Aristolochia rotunda) und die Bleiche Osterluzei (Aristolochia pallida). Die Osterluzeifalter-Raupen (Zerynthia polyxena) dort entwickeln sich nur vollständig, wenn sie sich von der Bleichen Osterluzei ernähren. Fressen die Raupen hingegen an den anderen beiden Osterluzei-Arten, dann entwickeln sie sich zuerst ganz normal bis zum 3. Larvenstadium, schaffen es aber nicht bis zum Puppenstadium. Dieses Wissen ist für den Schutz des Falters für sein dortiges Vorkommen sehr wichtig, denn für den Oberitaliener-Osterluzeifalter ist Osterluzei eben nicht gleich Osterluzei – der mag es noch spezieller als speziell.
Zum Abschluss: Ein Spezialbeitrag für Botanik-Begeisterte
Hereingeflattert in die Pflanzenwelt - Die Gewöhnliche Osterluzei/Aufrechte Osterluzei (Aristolochia clematitis)
In Schmetterlingsportraits ist die Beschreibung der Raupen-Nahrungspflanze meist kurzgehalten. Wichtig für den Schutz und die Förderung der Schmetterlingsart sind ja vor allem Kenntnisse über Verbreitung und Standortbedürfnisse der Nahrungspflanzen – diese Information haben wir in der Einleitung schon beschrieben.
Einen detaillierteren Blick auf die Gewöhnliche Osterluzei oder Aufrechte Osterluzei (Aristolochia clematitis) möchten wir allen Botanik Begeisterten aber nicht vorenthalten. Die Pflanze wurde in Mitteleuropa im Mittelalter als eine der ältesten bekannten Heilpflanzen eingebürgert und in Klostergärten kultiviert. Sie galt als geburtsfördern, woher auch ihr Name stammt (griech. aristos = der Beste, locheia = Geburt) und wurde zudem zur Therapie von Schlangenbissen verwendet. Heute ist ihre Anwendung verboten (Ausnahme Homöopathie), da ihr Pflanzengift - die Aristolochiasäure - unter anderem als nierenschädigend und krebserregend gilt.
So gewöhnlich ihr Name auch klingt, so ungewöhnlich ist sie im Hinblick auf ihre Bestäubungsökologie. Die Vermehrung der Gewöhnlichen Osterluzei, die bis zu einem Meter hoch werden kann, erfolgt in unseren Breitengraden eher unspektakulär überwiegend über unterirdisch gelegene, verdickte Sprossachsen – das sogenannte Rhizom (also ohne Bestäubung).
Exkurs für besonders Wissbegierige Gartenfans: Die Sprossachse – je nach Form auch Stängel, Stamm, Halm, usw. genannt - ist normalerweise jener Teil von Pflanzen, der die Laubblätter und Blüten trägt. Sie verbindet die Blätter und Wurzeln miteinander und sorgt für den Stofftransport zwischen ihnen. Die Gewöhnliche Osterluzei, aber z.B. auch Giersch, Schwertlilien oder Ingwer haben ein meist unterirdisch gelegenes, spezialisiertes Sprossachsensystem – das sogenannte Rhizom. Es ist eine dicke, in der Regel verzweigte Struktur, die horizontal im Boden wächst. Rhizome dienen der Pflanze zu verschiedenen Zwecken, wie der Speicherung von Nährstoffen und Wasser, der geschützten Überwinterung und der Vermehrung der Pflanze. Das können wir uns im Garten zunutze machen, indem Teile des Rhizoms glatt und sauber abgetrennt, und an anderer Stelle wieder eingepflanzt werden. Schwertlilien lassen sich so, am besten im August, sehr einfach vermehren: www.naturimgarten.at/gartenwissen/videotipps/tipp/schwertlilien-teilen.html
Im mediterranen Raum bildet die Osterluzei aber auch Samenstände aus, und dazu müssen die Blüten vorher bestäubt werden – und hier wird’s richtig interessant. Die ungewöhnlichen, gelblichen, länglichen Röhrenblüten bilden (vom Prinzip ähnlich wie z.B. die fleischfressenden Kannenpflanzen) eine sogenannte Kesselfalle. Kleine Fliegen, die vom herben Blütengeruch angelockt werden und in die Blüte hineinkriechen, können sie aufgrund nach innen gerichteten Haaren zunächst nicht wieder verlassen. Sie werden von der Pflanze aber nicht „gefressen“. Die Bestäuber werden stattdessen mit Nektar versorgt. Erst nach etwa zwei Tagen erschlafft sie und die Fliege, welche voll mit Pollen ist, wird in die Freiheit entlassen in der Hoffnung, dass diese die nächste Blüte besucht und es somit zu einer Befruchtung kommt.
Die Natur ist eben erfinderisch - Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht – wir wünschen jedenfalls viel Freude beim (Weiter-)staunen!

Bei der Wahl zum Schmetterling des Jahres, ausgerufen durch die BILLA Stiftung Blühendes Österreich und die NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“, gab es einen klaren Sieger: Das Tagpfauenauge! Ein bunter Schmetterling über den es viel zu sagen gibt.
Zeitig im Jahr, wenn Frühlingsblüher wie Weiden und Schlehen blühen, kann das Tagpfauenauge, welches zoologisch Inachis io heißt, als einer der ersten Blütenbesucher beobachtet werden. Diese farbenprächtigen Edelfalter überwintern nicht als Ei, Raupe oder Puppe, sondern als erwachsene Falter in frostgeschützten Nischen, Kellerröhren, Dachböden, Gartenhütten, kleinen Höhlen etc. Die Flügelspannweite beträgt zwischen sechs bis sieben Zentimeter.
Wie bei allen anderen Arten dieser großen Familie – darunter Admiral, Trauermantel, Schillerfalter, Eisvogel, Großer und Kleiner Fuchs, C-Falter und Distelfalter – ist auch beim Tagpfauenauge das erste Beinpaar verkümmert und zu so genannten Putzpfoten umgewandelt. Und wie bei Kleinem Fuchs, Admiral und Landkärtchen ernähren sich die Raupen nahezu ausschließlich von Brennnesseln, weshalb diese Arten auch als Brennnesselfalter zusammengefasst werden. Die jungen Raupen, welche ausschließlich auf Großer Brennnessel und Hopfen zu finden sind, sind zunächst grüngelb gefärbt, später leuchtend schwarz mit weißen Punkten und glänzenden Stacheln und können eine Größe von 4 Zentimetern erreichen. Der erwachsene Falter legt Eier in einer großen Anzahl, oft mehrere Hundert Eier, zusammen auf die Blätter der Brennnesseln ab. Die Raupen schlüpfen gemeinsam und überziehen die Pflanze mit einem Gespinst. Bevorzugt werden sonnige Standorte, bei denen die Brennnesseln einen größeren Bestand bilden. Vor der Verpuppung gehen die Raupen aus dem Gespinst ihre eigenen Wege und suchen nach einem geeigneten Ort dafür. Einmal verpuppt, hängen diese als braune, gut getarnte Stürzpuppen senkrecht Richtung Boden. Das Tagpfauenauge ist, ausgenommen von Nord-Skandinavien, in weiten Teilen Europas beheimatet. Auch in Österreich ist es fast überall, bis in eine Höhe von 2500 m in Wiesen, lichten Wäldern, offenen Landschaften, Gärten, Parks und in Städten zu finden. Meistens können zwei Generationen im Jahr gebildet werden. Die erste Generation schlüpft dabei ab Juli, die zweite ist je nach Witterung vor allem im September oder Oktober zu finden.
Im Gegensatz zu den Raupen, welche vor allem Brennnesseln zum Überleben brauchen, ist es bei den erwachsenen Tieren gänzlich anders. Diese trinken Nektar von heimischen Weiden, Schlehen, Huflattich, Efeu, Löwenzahn, Disteln, Wasserdost, Flockenblumen, Skabiosen, Klee und Luzerne. Aber auch von den bei Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzern beliebten Gartenpflanzen wie Obstbäumen, Astern, Hohem Eisenkraut, Sonnenhut und vielen mehr. Dazu kommt noch, dass das Tagpfauenauge, wie andere Schmetterlingsarten auch, als erwachsenes Tier gerne an am Boden liegenden oder auch hängenden gärenden Obst die fauligen Fruchtsäfte trinkt. Das Tagpfauenauge ist also eine Art, die nicht nur häufig in Gärten zu sehen ist, sondern durch die gezielte Förderung von Brennnesseln als Raupenfutterpflanzen an sonnigen Standorten und Nektarpflanzen für die erwachsenen, bunten Falter gefördert werden kann.

„Ich sehe immer weniger Schmetterlinge“ lässt sich häufiger vernehmen. Ja das Verschwinden von bunten Faltern ist für uns offensichtlich und leider auch schon sehr auffällig. Das dieser Rückgang häufig mit unserem, gerade in der ruhigen Jahreszeit, wenn weniger im Garten zu tun ist, plötzlich auftretenden Putzfimmel zu tun hat, kommt vielen – ohne es böse zu meinen - nicht in den Sinn. Schmetterlinge sind kurzlebige Wesen der warmen Jahreszeiten. Den Winter überdauern viele Arten als Ei, Raupe oder Puppe an schützenden Strukturen - gut getarnt und für unser Auge oft nicht wahrnehmbar, doch das sind die Schmetterlinge der kommenden Jahre. Wenn wir uns im Herbst und Winter in unser wohlig warmes zu Hause zurückziehen, steht für zahlreiche Lebewesen vor unseren Haustüren eine richtig harte Zeit an. Jede Struktur die Unterschlupf und Überwinterungsmöglichkeit bietet, ist deshalb sehr wertvoll. In unseren Gärten und auch auf öffentlichen Grünflächen können außerdem eine Vielzahl an Schmetterlingen gefördert werden, indem die richtigen Raupenfutterpflanzen gezielt gepflanzt oder bei der Gartenpflege stehen gelassen werden. Es liegt an uns, unsere Einstellung von „ordentlich“ in Richtung „schlampert“ zu verändern und vor allem auch im öffentlichen Grünraum mehr Toleranz gegenüber „wilden“ Bereichen zu entwickeln. Außer Frage lautet das Motto zudem: pflanzen, pflanzen, pflanzen, und zwar so vielfältig wie möglich – denn nur aus jeder überlebenden Raupe kann auch ein Schmetterling schlüpfen!
Wichtige Raupenfutterpflanzen
Allgemein bekannt ist, dass die Große Brennnesseln eine wichtige Raupennahrungspflanze für insgesamt 25 heimische Schmetterlingsarten (darunter Admiral, Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, C-Falter, Landkärtchen und viele mehr) sind. Vor allem der beliebte Admiral braucht die Große Brennnessel fürs Überleben, denn ohne diese Pflanze verhungern dessen Raupen. Daher macht es Sinn, Brennnesseln im Garten oder Grünraum Platz einzuräumen, um diese bunten Falter zu fördern. Dabei ist es wichtig Brennnesseln an verschiedenen Plätzen (sonnig, halbschattig und schattig/feucht) wachsen und auch über den Winter stehen zu lassen, denn die Puppen ruhen häufig an oder nahe der Futterpflanze bis zum Wunder der Verwandlung. Die Bedürfnisse der „Brennnesselfalter“ sind unterschiedlich. Das Tagpfauenauge etwa, braucht sonnige bis maximal halbschattige und große Bestände mit mittlerer bis hoher Luftfeuchtigkeit. Der Kleine Fuchs bevorzugt es trocken bei geringer, das Landkärtchen hingegen halb- bis vollschattig bei hoher Luftfeuchtigkeit, beide gerne in großen Brennnesselbeständen. Der Admiral mag lieber kleinere Bestände an Randstrukturen, die sonnig bis halbschattig gelegen und bevorzugt feuchtes Klima bieten sollen.
Heimische Zwergsträucher wie die Heidelbeere oder die Besenheide versorgen über 100 bzw. 80 Schmetterlingsarten - vor allem Nachtfalter und darunter wiederum sehr spezialisierte Spezies - mit Raupennahrung. So tragen Schmetterlingsarten wie das Heidekraut-Eulchen, der Blassgrüne Heidelbeerspanner oder der Hochmoor-Bläuling die Futterpflanze oder den benötigten Lebensraum mit bestimmtem Pflanzeninventar, bereits im Namen.
Unter den Bäumen und Sträuchern sind Stiel- und Traubeneiche hervorragende Raupenbäume für über 150 Falterarten, darunter etwa Nachtfalter wie das Blaue, Rote und Gelbe Ordensband oder der Eichenspinner, der Eichenkarmin, die Eichenglucke, die Olivgrüne Eicheneule oder Tagfalter wie der Blaue oder der Braune Eichen-Zipfelfalter. Die Raupen von über 100 Schmetterlingsarten verköstigen Birke (z.B. Trauermantel, Nierenfleck-Zipfelfalter, Abendpfauenauge, Lindenschwärmer) sowie Schlehe/Schwarzdorn und Sal-Weide mit ihrem Blätterdach.
Weiden, allen voran die Sal-Weide, spielen eine wichtige Rolle als Nahrungspflanze für Raupen und, in Puncto Blüten und Nektar, auch für Falter. Blüten von Bäumen spielen in der Regel eine untergeordnete Rolle als Falternahrung, doch die schon früh im Jahr blühenden Sal-Weiden und auch Obstbäume dienen überwinternden Schmetterlingen wie Zitronenfalter, Tagpfauenauge und Kleinem Fuchs, sowie vielen anderen Insekten als erste, unersetzliche Nahrungsquelle. Palmkätzchen sollten deshalb nur sehr zurückhaltend für Ostern geschnitten werden. Die Blätter von Weiden, vor allem der Sal-Weide, sind überwiegend bei Nachtfalterraupen beliebt, aber auch der Trauermantel sowie Kleiner und Großer Schillerfalter brauchen die Blätter der Sal-Weide als Raupenfutter.
Zu den über 100 Arten versorgenden Raupenfutterpflanzen zählt wie erwähnt auch die Schlehe. Sie ist wie die Sal-Weide ebenso ein wichtiges Nektargehölz für Falter und bietet zudem vielen weiteren Insektenarten wichtige Nahrung, um den noch blütenarmen, zeitigen Frühling zu überleben. Die Blätter werden von Segelfalter, Großer Fuchs und Zipfelfalterarten oder dem kleinen Nachtpfauenauge und den Raupen vieler anderer Falterarten zur Entwicklung benötigt. Reichlich Blätter zum Schmausen und Kinderstube für Falterraupen bieten auch anderer Gehölze wie Brom- und Himbeeren, Haselnuss, Wildrosen oder unsere beliebten Apfel- und Birnbäume.
Neben den Gehölzen ist die Bedeutung einer Vielzahl an Wildkräutern als unverzichtbare Raupennahrung hervorzuheben. Im Garten oder öffentlichen Grün zählen viele von ihnen zu den wenig beliebten Pflanzenarten oder werden (nicht immer und überall notwendig) als Unkraut gänzlich und gründlich entfernt. Für zahlreiche Schmetterlingsarten sind aber gerade diese Pflanzen lebensnotwendig. Hierbei gilt es einen guten Mittelweg zu suchen und die Toleranzgrenze auszuweiten, und ihnen dennoch einen Platz in Gärten und Grünräumen einzuräumen, wenn wir wieder mehr Schmetterlinge erleben möchten.
Ein gutes Beispiel hierfür sind diverse Kleearten, welche sich eigentlich gut in ganzjährige Staudenbeete oder Naturwiesen integrieren lassen. Einen für Gärtner spannenden Zieraspekt haben Hornklee, Hufeisenklee oder Wundklee. Diese sind neben Wicken eine unerlässliche Nahrungsquelle für die Raupen einer Vielzahl an Bläulingen und Gelblingen. Durch Kreuzblütler wie die Knoblauchrauke, die auch uns Menschen schmeckt und gern und pflegeleicht neben Hecken gedeiht aber auch die hier nicht heimische Kapuzinerkresse, lassen sich Weißlinge, wie Aurorafalter fördern.
Auf Veilchen sowie Stiefmütterchen finden sich die Raupen von Perlmuttfaltern. Eine große, bekannte und beliebte Perlmuttfalterart ist zum Beispiel der Kaisermantel. Die Weibchen legen ihre Eier nicht direkt an die Raupenfutterpflanzen, sondern nah von diesen gelegen in Rindenritzen von Bäumen ab. Gut geschützt über den Winter, machen sich die kleinen Raupen dann im Frühjahr mit großem Hunger auf den Weg zu den duftenden Veilchen.
Ampfer und Wiesenknöterich verköstigen Arten der farbenprächtigen Feuerfalter. Das in grün und blaugrün Tönen schillernde Sauerampfer-Grünwidderchen ist wieder ein Beispiel für eine auf Sauerampfer spezialisierte Schmetterlingsart. Das vielen bekannte Weißfleck-Widderchen frisst auch an Ampfer, nimmt aber gerne ebenso von gewöhnlichem Löwenzahn über die verschiedenen Labkraut-Arten bis hin zu den heimischen Taubnessel-Arten gemischte Blattkost zu sich, um eine schöne, fette Raupe zu werden. Sie teilt sich das Blatt-Buffet von, bei uns Menschen leider weniger beliebten, Wegerichen wie dem Spitzwegerich mit verschiedenen Scheckenfaltern. Die Raupen der Scheckenfalter finden sich zudem auch auf Ehrenpreis und Baldrian. Scheckenfalter fressen zwar als größere Raupe an recht unterschiedliche Pflanzen, sind aber zur Eiablage und als Jungraupen an ganz bestimmte Pflanzenarten gebunden und können in dieser Lebensphase auch nicht auf nächstverwandte Pflanzenarten ausweichen.
Da wir in Österreich mit über 4.000 Schmetterlingsarten zu den (noch) wirklich gesegneten Ländern Europas zählen, ließe sich die Beschreibung von Raupenfutterpflanzen noch ausgiebig fortführen. Die wesentliche Botschaft der hier vorgestellten Raupen(-Futterpflanzen) ist: je mehr Vielfalt und vor allem heimische Vielfalt an Pflanzenarten in einem Garten oder jeglichem anderen Grünraum Platz findet - und sei dieser noch so klein – desto mehr Raupen können sich in die von uns Menschen so geliebten Schmetterlinge verwandeln. Es ist unsere Aufgabe Lebensraum mit der Vielfalt anderer Arten zu teilen und so zur Erhaltung dieser wertvollen Geschöpfe beizutragen.

Das Wiener Nachtpfauenauge (Saturnia pyri) aus der Familie der Pfauen- oder Augenspinner, ist einer der bekanntesten der knapp 3.900 Nachtfalterarten Österreichs und mit einer beeindruckenden Flügelspannweite von bis zu 16 cm (was etwa der Größe einer Hand entspricht) der größte Falter Mitteleuropas. Die Art kommt in Südeuropa und Nordafrika, sowie im Nahen Osten vor, wobei Niederösterreich die Nordgrenze des Verbreitungsgebiets darstellt. Obwohl das Wiener Nachtpfauenauge eigentlich ein breites Nahrungsspektrum hat, ist der Bestand rückläufig, weshalb der schöne Nachtfalter hierzulande als gefährdet gilt und streng geschützt ist. Die Raupen ernähren sich von den Blättern verschiedener Laubgehölze, bevorzugt von Obstbäumen wie Kirsche, Apfel, Zwetschke aber auch Walnuss, Bergahorn und Haselnuss sowie Schlehe, Him- und Brombeere oder Heidelbeere. Der Raupenfraß wirkt sich nicht kulturschädigend aus. Eine Besonderheit im Hinblick des für uns „klassischen“ Schmetterlings ist, dass die erwachsenen Falter nur verkümmerte Mundwerkzeuge besitzen und daher überhaupt keine Nahrung zu sich nehmen. Sie zehren, während ihres nur wenige Tage dauernden Lebens, ausschließlich von den Fettreserven, welche sie sich als Raupe zugelegt haben. Als Lebensraum dienen offenes, locker verbuschtes Gelände, Waldränder, Obstgärten, Parkanlagen und Alleen sowie Naturgärten.
Flauschige Falter
Die Weibchen und Männchen unterscheiden sich in ihrer Flügelfärbung nicht. Die Flügelfärbung ist geprägt von beige, braun, grau und weinrot Tönen, der äußere Flügelrand ist creme- oder beigefarben. Der riesige Falter hat ein beinahe flauschiges Aussehen und ist völlig harmlos, obwohl ein Exemplar (aus eigener Erfahrung) zu seinem Unglück sogar schon mit einer tropischen Spinne verwechselt wurde. Besonders auffällig sind die, wie bei vielen Pfauenspinnern, ausgeprägten Augenflecken auf den Vorder- und Hinterflügeln. Bei Gefahr abrupt aufgeklappt, wirken die Augenflecken wie die Augen eines großen Tieres, was Fressfeinde im besten Fall kurz ablenkt oder abschreckt und Zeit zur Flucht verschafft.
Deutlich unterscheiden lassen sich männliche und weibliche Tiere anhand der Fühler: diese sind bei den Männchen stark gekämmt bzw. fächerartig, bei den Weibchen hingegen nur schwach gezähnt. Im Mai begeben sich die männlichen Tiere nachts mit Hilfe dieser fächerartigen Fühler auf die Suche nach paarungsbereiten Weibchen. Meist reglos an Baumstämmen sitzend, geben diese Sexuallockstoffe (Pheromone) ab. Dieses betörende „Parfum“ kann von den Männchen über mehrere Kilometer Entfernung mit den sensiblen Fühlern wahrgenommen werden. Kurz nach der Paarung oder innerhalb der folgenden zwei Nächte werden die Eier bevorzugt an dünnen Ästen alter Obstbäume abgelegt und das Leben der Falter endet.
„Sprechende“ Raupen
Die Weibchen legen bis zu 200 rötlich-braun gefärbte Eier auf passenden Raupenfutterpflanzen ab. Das klingt im ersten Moment viel, doch das Leben als Raupe ist gefährlich und nur einige werden die Entwicklung bis zum Falter schaffen. Schmetterlinge und insbesondere deren Raupen stehen nämlich am Speiseplan vieler anderer Tierarten. Viele unserer Gartenvögel z.B. ziehen ihre Küken unter anderem mit Raupen auf und auch auf dem Speiseplan von Igeln sind Raupen ein wichtiger Bestandteil. Nicht nur um der hübschen Falter willen ist Schmetterlingsschutz deshalb sehr wichtig. Oft fallen die Eier in Gärten und im öffentlichen Grünraum Schnittmaßnahmen aber auch Pestiziden zum Opfer.
Die Entwicklung vom Ei bis zur Verpuppung der Raupe verläuft über fünf Raupenstadien und dauert etwa 10–12 Wochen. Frisch geschlüpfte Raupen sind etwa 5 mm lang, schwarz gefärbt und mit 4 Reihen roten bzw. hellbraunen, borstentragenden Punktwarzen geschmückt. Da die Haut wie bei allen Insekten nicht mitwachsen kann, streifen die Raupen regelmäßig ihre Haut ab und sehen je nach Raupenstadium sehr unterschiedlich aus. Die kleine Raupe Nimmersatt kann in ihrem letzten Stadium eine stattliche Größe von 120 mm erreichen. Sie ist dann hellgrün gefärbt mit himmelblauen Punktwarzen, aus denen skurril anmutende, schwarze Borsten wachsen. Im fortgeschrittenen Alter können die Raupen des Wiener Nachtpfauenauges mit ihren Mundwerkzeugen sogar zirpende Geräusche erzeugen, um Fressfeinde wie Vögel oder Fledermäuse abzuwehren. Am Ende ihrer Entwicklung, wenn die Verpuppung bevorsteht, färben sich die Raupen gelblich orange. Die Überwinterung erfolgt als Puppe. Die Verpuppung findet am unteren Teil von Stämmen, oft direkt am Fuß des Nahrungsgehölzes, aber auch an geschützten Stellen von z.B. Mauern statt. Die Raupen spinnen einen festen pergamentartigen Kokon, die Puppenphase kann ein bis drei Jahre dauern. An einem Ende dieses Kokons befindet sich hinter einer runden Öffnung eine Reuse aus starren Borsten, die Feinde abhält. Der fertig entwickelte Falter kann durch diese Öffnung zudem leichter schlüpfen. Die Tiere schlüpfen je nach Witterung zwischen Anfang und Ende Mai und sind dann in diesem Zeitraum nur für wenige Tage auf der Suche nach Paarungspartnern zu sehen.
Nachtfalter-Liebe braucht Dunkelheit
Die Falter des Wiener Nachtpfauenauges sind nachtaktiv. Vermeintlich „eh klar“, aber die Einteilung in Tag- und Nachtfalter ist nicht ganz so eindeutig wie sie scheint. Alle Tagfalterarten sind tagaktiv, aber nicht alle Nachtfalterarten sind nachtaktiv. Für Schwärmer eher untypisch, ist z.B. das vielen bekannte Taubenschwänzchen, das durch seine Flugweise an einen Mini-Kolibri erinnert, überwiegend tagaktiv. Die Aktivität kann sich in die Morgen- und Abendstunden verschieben, wenn es dem Taubenschwänzchen tagsüber zu heiß wird. Viel weniger sind uns hingegen die tatsächlich nachtaktiven Nachtfalter wie das Wiener Nachtpfauenauge vertraut. Die imposanten Falter fallen aufmerksamen Menschen z.B. beim Umschwärmen von künstlichen Lichtquellen auf, wo sie aufgrund ihrer Größe manchmal sogar mit Fledermäusen verwechselt werden. So erfreulich diese Beobachtung auch ist, für den Falter handelt es sich hierbei um eine tragische Situation. Lichtverschmutzung ist für das Wiener Nachtpfauenauge, ebenso wie für viele andere nachtaktive Tierarten auch, eine ernstzunehmende Problematik. Weibchen und Männchen bleibt aufgrund ihrer kurzen Lebensdauer als Falter nur wenige Tage Zeit, um sich zu finden und zu paaren. Angezogen vom Licht, verrinnt die kurze Lebenszeit allzu schnell, bevor die Paarung überhaupt stattgefunden hat. Die reflektierte Wahl und der sorgsame Umgang mit Außenbeleuchtung sind deshalb wichtig. Dadurch können wir Lichtverschmutzung und ihre negativen Folgen, welche auch uns Menschen betreffen, deutlich verringern. Näheres darüber findest du im Blog „Nachtfalter in ‚Heller Not‘ – Lichtverschmutzung verringern“. Eine stockdunkle, sternenklare Nacht ist nicht nur wunderschön, sondern auch überlebensnotwendig für zahlreiche Tierarten.

Wir alle kennen das typische Bild vom Schmetterling, der auf einer Blüte sitzt und mit seinem langen Rüssel Nektar schlürft. Die Vorstellung des klassischen Schmetterlings mit Saugrüssel und Flügeln stimmt auch für viele Arten, deren Leben als Flattertier mit der Entfaltung dieser „schmetterlingstypischen“ Eigenschaften beginnt.
Nach dem Schlupf aus der Puppe werden die anfangs noch schrumpeligen, weichhäutigen Flügel durch Einpressen von Körperflüssigkeit (Hämolymphe) in die Flügeladern wie bei einem Ballon zu ihrer vollen Größe entfaltet. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, wird die Flüssigkeit aus den Flügeladern zurückgezogen und füllen sich mit Luft. Die vorher noch weiche Flügelmembran erstarrt dabei und härtet aus. Außerdem besteht der Saugrüssel nach dem Schlupf zunächst noch aus zwei getrennten Halbrohren. Durch oftmaliges Aus- und Einrollen werden die beiden Teile fix miteinander „verklebt“. Der fertige Saugrüssel wird dann in Ruhestellung spiralig eingerollt. Erst jetzt ist der Falter bereit für seinen ersten Flug. Falter mit Rüssel können nur flüssige Nahrung zu sich nehmen und sind weitgehend auf Nektar angewiesen. Nektar eignet sich als „Treibstoff“ für die Flugmuskulatur, nicht jedoch zum Muskelaufbau und weitgehend auch nicht zur Eiproduktion. Die dafür nötigen Vorräte muss sich der Schmetterling also bereits im Entwicklungsstadium als Raupe anfressen.
Mit dem typischen Schmetterlingsbild im Kopf, ist es vielleicht nur schwer vorstellbar, dass es Schmetterlingsarten gibt, die keinen Rüssel besitzen. Die ursprünglichsten Falterfamilien haben noch keinen Rüssel, sondern beißend-kauende Mundwerkzeuge. In Mitteleuropa sind die bunten, aber nur wenige Millimeter großen Urmotten, die als Falter Pollen fressen, zu finden.
Unter den Nachtfaltern gibt es zudem viele Arten, deren Mundwerkzeuge stark rückgebildet sind. Diese Arten nehmen als erwachsene Falter keine Nahrung mehr zu sich, sondern zehren während ihres nur wenige Tage dauernden Lebens ausschließlich vom „Speck“, den sie sich als Raupe zugelegt haben. Ihr Leben besteht nur aus Luft und Liebe – sie pflanzen sich fort und sterben bald danach. Einer der bekanntesten dieser Falterarten ist das Wiener Nachtpfauenauge, welches mit einer Flügelspannweite von bis zu 16 cm der größte europäische Schmetterling ist. Die auffälligen Augenflecken auf den Vorder- und Hinterflügeln der imposanten Tiere dienen dazu, Fressfeinde abzuschrecken. Im Mai begeben sich die mit fächerartigen Fühlern ausgestatteten, männlichen Tiere nachts auf die Suche nach paarungsbereiten Weibchen. Meist reglos an Baumstämmen sitzend, geben diese Sexuallockstoffe (Pheromone) ab, die von den Männchen bis in 5 km Entfernung wahrgenommen werden können. Kurz nach der Paarung oder innerhalb der folgenden zwei Nächte werden die Eier bevorzugt an dünnen Ästen alter Obstbäume abgelegt und das Leben der erwachsenen Tiere endet.
Ein weiterer „untypischer“ Schmetterling ist der Frostspanner. Auch dieser besitzt als ausgewachsener Falter keinen Rüssel oder Mundwerkzeuge. Hinzu kommt bei Frostspannern, dass das Weibchen auch keine Flügel besitzt. Spät im Jahr und erst nach Frosteinwirkung, die den entsprechenden Entwicklungsanreiz setzt, klettern die Weibchen „per pedes“ den Baumstamm hinauf, werden von den flugfähigen Männchen aufgesucht und paaren sich. Die Eier werden dann in Rindenvertiefungen an der Baumkrone abgelegt, die erwachsenen Tiere sterben bald danach. Die im darauffolgenden Frühjahr schlüpfenden Raupen, welche durch ihre typische buckelartige Fortbewegung auffallend sind, lassen sich ab Mai mit einem Spinnfaden zu Boden herab. Dort verpuppen sie sich in etwa 10 cm Bodentiefe. Im Oktober schlüpfen nach Frosteinwirkung wieder die grau-braunen Falter und der Kreislauf beginnt von neuem.
Die Natur bietet stets Unglaubliches zu entdecken, das zu Erstaunen vermag – und so sind auch viele unserer heimischen Schmetterlingsarten ganz anders als zunächst gedacht!

Der Winter hat Einzug gehalten und es ist still geworden in der Natur. In dieser Jahreszeit wird besonders spürbar, wie sehr unsere Gärten und Grünräume im Rest der Zeit von Lebendigkeit erfüllt sind. Je weiter der Winter voranschreitet, desto mehr wächst die Sehnsucht nach dem ersten Grün, nach den bunten Farben der Frühjahrsblüher und den ersten Frühlingsboten aus dem Tierreich, wie dem Zitronenfalter. Damit sich diese Sehnsucht alljährlich erfüllen kann, liegt es an uns, Privatgärten und öffentliches Grün im Sinne der Artenvielfalt zu gestalten und zu pflegen. Jetzt im Winter ist die Zeit, um über die Neu- oder Umgestaltung und neue Projekte nachzudenken. Der Trend zur Naturentfremdung von Gärten und Grünräumen mit Zierrasenflächen, Kirschlorbeer, abgeschottet durch Zäune auf Betonsockeln, aufgeräumt und im wahrsten Sinne „totgepflegt“ – auch wenn es grundsätzlich niemand böse meint – braucht dringend eine Umkehr. Je aufmerksamer wir Grünflächen vor allem als Lebensraum wahrnehmen und bei der Planung mitdenken, desto eher schenken wir uns selbst und unseren Mitmenschen nicht nur Hoffnung auf einen Frühling voller Leben, sondern wachsenden, gesunden Lebensraum für alle.
Alles ist verbunden
Schmetterlinge sind nicht nur hübsche, bunte Gartenbesucher, sie haben auch wichtige ökologische Funktionen. Ebenso wie zahlreiche andere Insektenarten, zählen sie zu den Bestäubern von Pflanzen. Außerdem stellen die Falter und insbesondere ihre Raupen eine bedeutende Nahrungsquelle für andere Tierarten dar. Denken wir dieser Tage, wenn wir uns am Besuch von Meisen, Finken und Drosseln am Vogelfutterhäuschen freuen daran, dass die meisten Vogelarten allerlei Insekten und Spinnentiere brauchen, um ihre Jungen großzuziehen. Auch das Wappentier der Umweltbewegung „Natur im Garten“, der Igel, zählt zu den Insektenfressen. Für viele Menschen ist die Begegnung mit Igeln oder gar Igelbesuch im eigenen Garten ein echtes Highlight. Neben Käfern machen Schmetterlingsraupen je nach Jahreszeit mehr als 43 % der natürlichen Nahrung von Igeln aus. Wollen wir uns also an Vogelbeobachtung, Igelbegegnungen und vielen weiteren Tierarten, die Insekten als Nahrung brauchen, weiterhin erfreuen, ist es notwendig so viele Privatgärten und Gemeindegrünflächen wie möglich naturnah zu gestalten, zu pflegen und die einzelnen Flächen zu einem Netzwerk miteinander zu verbinden. Wie das geht? Mit „Natur im Garten“ und Blühendes Österreich: unter www.naturimgarten.at und www.bluehendesoesterreich.at findest du Interessantes und Wissenswertes zu Schmetterlingen sowie Informationen rund um das ökologische Gärtnern für Privatgärten und Gemeinden – damit wir gemeinsam für wertvollen Lebensraum für unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt sorgen können.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
Ob Schmetterlingsprofi oder frisch geschlüpfter Fan der heimischen Falterwelt – die Schmetterlings-App bringt alle, deren Herz für Schmetterlinge schlägt, zu einer bunten Gemeinschaft zusammen. Mit dem Frühlingserwachen flattern auch die Schmetterlinge wieder in unsere Gärten und Grünräume – werde ein Teil der größten Schmetterlings-Familie Österreichs und hilf mit, gemeinsam wertvolles Wissen über unsere heimische Faltervielfalt zu sammeln: www.schmetterlingsapp.at
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, allen Schmetterlingsbegeisterten, die uns schon letztes Jahr in dieser Artikelreihe rund um die heimische Faltervielfalt unter www.naturimgarten.at/schmetterlinge begleitet haben, einen schönen Jahresanfang und zahlreiche falterhafte zukünftige Gartenmomente!

Die Bläulinge gehören zu den kleinen, jedoch nicht weniger farbenprächtigen Tagfaltern. Etwa 5.200 Arten gibt es weltweit, 144 in Europa und 51 plus 3 Gelegenheitsgäste in Österreich. „Typische“ Bläulinge sind blau oder braun, es gibt aber auch eine Gruppe orangeroter Arten (Feuerfalter) sowie die Zipfelfalter mit schwalbenschwanzähnlichen Fortsätzen der Hinterflügel. Die Mehrzahl der Bläulings-Arten ist standorttreu (also nicht wanderfreudig) und deshalb auf den bereits besiedelten Lebensraum stark angewiesen. Da Ersatzlebensräume kaum erreicht werden, ist für ihren Schutz vor allem der Standorterhalt für etablierte Vorkommen wichtig.
Die Raupen der Feuerfalter leben an Ampfer oder Knöterich, Zipfelfalter an verschiedenen Gehölzen. Die „typischen“ Bläulinge nutzen je nach Art sehr unterschiedliche Pflanzen zur Eiablage. Oft findet sich die Raupenfutterpflanze, wie z.B. beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling, dem Storchschnabel-Bläuling oder dem Kreuzenzian-Bläuling, bereits im Namen der Schmetterlingsart. Viele Bläulings-Arten mögen jedenfalls Schmetterlingsblütler zu denen z.B. verschiedene Kleearten gehören. Eine Spezialität unter den Bläulingen ist, dass einige Arten nur kurz an ihrer eigentlichen Eiablagepflanze fressen, dann aber den Rest des Raupenlebens als Parasiten in Ameisenbauten verbringen.
Ein interessantes Beispiel hierfür ist der Kreuzenzian-Bläuling. Er ist eine extrem standorttreue Art der Kalkmagerrasen, fliegt maximal 2,5 km weit und tritt als Falter nur von Mitte Juni bis Mitte Juli in Erscheinung. Das Weibchen legt an der einzig möglichen Raupennahrungspflanze, dem Kreuz-Enzian (Gentiana cruciata), seine Eier ab. Nachdem sich die Raupen von den Staubbeuteln, Fruchtknoten und Samenanlagen der Blüte ernährt und dreimal gehäutet haben, lassen sie sich im Spätsommer zu Boden fallen. Knotenameisen der Art Myrmica schencki tragen die Raupen in ihr Nest und füttern sie bis zur Verpuppung im nächsten Jahr – und das nur weil die Schmetterlingslarven zur Anpassung den Geruch der Ameisenlarven imitieren, zwischen denen sie liegen. Da sie ähnliche Geräusche wie die Ameisenköniginnen erzeugen, werden sie bei Gefahr sogar bevorzugt gerettet. Durch seine geringe Mobilität und starke Abhängigkeit von Knotenameisen und Kreuz-Enzian auf den selten gewordenen Kalkmagerrasen ist der Kreuzenzian-Bläuling heute eine stark bedrohte Schmetterlingsart. Daher ist es wichtig, diese speziellen Lebensräume zu schützen.
Der Faulbaumbläuling ist hingegen eine Art die häufiger in Gärten und Parkanlagen in Erscheinung tritt. Sowohl Männchen als auch Weibchen sind blau gefärbt. Die blaue Färbung der Flügeloberseiten reicht bei den Weibchen jedoch nicht bis zum Flügelrand. Unterseits sind die Falter weiß blau gefärbt und zeigen eine unauffällige schwarze Zeichnung. Das Futterspektrum der Raupen ist relativ breit denn diese ernähren sich von den Blättern von Johannisbeeren, Faulbaum, Zwergginster, Lupinen, Heidelbeeren, Wicken, Hartriegel, Apfelbaum, Prunus, Vogelknöteriche, Eichen, Blutweiderich aber auch verschiedenen Kleearten und Luzerne.
Die große Gruppe der Bläulinge verdeutlicht, dass die Förderung und der Erhalt von Schmetterlingsarten oft nicht einfach durch einheitliche bzw. breitenwirksame Maßnahmen erfolgen kann. Die Lebensräume, Entwicklungsgeschichten und der Anspruch an bestimmte Raupenfutterpflanzen können so speziell sein, dass es sehr gezielte Maßnahmen zum Schutz und Erhalt solcher Schmetterlingsarten braucht.
Mit dem Smartphone zum Schutz von Schmetterlingen beitragen
Grundsätzlich können wir selbstverständlich alle dazu beitragen, dass unsere Umgebung Lebensraum für Schmetterlinge ist und bleibt, indem wir unsere Gärten und Grünräume ökologisch pflegen und naturnah gestalten. Damit aber auch sehr spezialisierten Arten unter die Flügel gegriffen werden kann, gibt es eine sehr nützliche App, mit der jede und jeder helfen kann, wichtige Daten rund um unsere Schmetterlingsvielfalt zu sammeln. Lade dir dazu die Schmetterlingsapp „Schmetterlinge Österreichs“ kostenlos über den App-Store von Apple oder Android herunter. Auf www.schmetterlingsapp.at gibt es auch eine Desktopversion. Fotografiere einen Falter und lasse ihn mithilfe des Schwarms bestimmen. Die Daten dienen der professionellen Schmetterlingsforschung, denn so erlangen wir mehr Kenntnis über Verbreitung, Vorkommen und Häufigkeit unserer Schmetterlingsarten in Österreich. Dadurch können passende Schutzmaßnahmen für die jeweiligen Arten erarbeitet und umgesetzt werden. So smart geht Schmetterlingschutz mit deinem Handy!

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, die Fruchtreife der Obstgehölze ist voll im Gange und der Herbst lässt langsam viele unserer Sträucher in den buntesten Gelb-, Orange- und Rottönen erstrahlen. Für ein gelungenes Saisonfinale wünschen wir uns im Garten und auf dem Balkon natürlich - ebenso wie unsere Schmetterlinge und zahlreiche andere Insektenarten auch – viele, schöne Blüten. Der Höhepunkt der Blütezeit geht mit dem Ende des Sommers zwar vorbei, dennoch gibt es Pflanzen , welche erst in der dritten Jahreszeit ihre ganze Pracht zur Schau stellen und neben der Herbstfärbung mit ihren Blüten reichlich Farbe in den Garten zaubern. Viele dieser dankbaren Spätsommer- und Herbstblüher sind auch für Schmetterlinge, deren Raupen und andere Insekten eine wichtige Nahrungsquelle. Einerseits können manche Schmetterlinge in einem warmen Herbst noch eine weitere Generation hervorbringen, andererseits müssen sich Schmetterlinge wie Zitronenfalter, Kleiner Fuchs oder Tagpfauenauge auf die Überwinterung vorbereiten. Blüten mit einem hohen Nektargehalt sind für diese Arten deshalb besonders wichtig. Nur einige wenige Schmetterlingsarten überdauern den Winter als fertige Falter, viele überwintern als Raupen (44 %) oder Puppe (50 %).
Aus der folgenden Auswahl an Pflanzen , welche teils bereits im Sommer blühen und deren Blütezeit sich bis weit in den Herbst hineinzieht oder welche im Herbst ihren Blühhöhepunkt erreichen, finden sich zahlreiche Schönheiten für ein buntes Saisonfinale. Die Herbstzeit ist außerdem die beste Jahreszeit, um im Garten neue Stauden und Gehölze für Schmetterlinge und ihre Raupen zu pflanzen.
Insbesondere heimische Wildpflanzen bieten Schmetterlingen und ihren Raupen, aber auch Wildbienen viel Nahrung. Bei der Pflanzenwahl ist es immer wichtig, die Standortansprüche der Pflanzenart zu berücksichtigen. Wähle die Pflanzen also passend nach ihren Bedürfnissen für den gewünschten Platz in deinem Garten aus. Unsere „Natur im Garten“ Partnerbetriebe bieten ein umfangreiches Sortiment und unterstützen dich gerne mit fachkompetenter Beratung bei der Pflanzenwahl: www.naturimgarten.at/partnerbetriebe
Auswahl an heimischen, herbstblühenden Wildpflanzen und Gehölzen (alphabetisch, nicht nach Wertigkeit gereiht, kein Anspruch auf Vollständigkeit)
Deutscher Name |
Botanischer Name |
Blühmonat |
| Berg-Aster | Aster amellus | 7-10 |
| Blutweiderich | Lythrum salicaria | 6-9 |
| Bunte Kronwicke | Securigera varia/Coronilla varia | 6-10 |
| Echtes Labkraut, Wiesen-Labkraut und andere Labkrautarten | Galium verum, Galium mollugo | 6-9, 5-9 |
| Echte Schafgarbe | Achillea millefolium | 6-10 |
| Echtes Seifenkraut | Saponaria officinalis | 6-9 |
| Färber-Hundskamille | Cota tinctoria/Anthemis tinctoria | 6-10 |
| Gemeine Nachtkerze (2-jährig) | Oenothera biennis | 6-9 |
| Großer Wiesenknopf | Sanguisorba officinalis | 6-9 |
| Gewöhnliches Bitterkraut/ Habichtskraut-Bitterkraut (2-jährig) | Picris hieracioides | 7-10 |
| Gewöhnliche Goldrute | Solidago virgaurea | 7-10 |
| Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 5-8 |
| Gewöhnlicher Natternkopf (2-jährig) | Echium vulgare | 5-9 |
| Gewöhnlicher Teufelsabbiss | Succisa pratensis | 7-10 |
| Gewöhnlicher Thymian/Feld-Thymian/Arznei-Thymian | Thymus pulegioides | 6-10 |
| Gewöhnlicher Wasserdost | Eupatorium cannabinum | 7-9 |
| Heidenelke | Dianthus deltoides | 6-10 |
| Heimische Distel-Arten (z.T. 2-jährig) | z.B. Cirsium sp., Carduus sp., Onopordum sp. | 6-9 |
| Karthäuser-Nelke | Dianthus carthusianorum | 5-9 |
| Kleines Habichtskraut | Hieracium pilosella | 5-9 |
| Knäuel-Glockenblume | Campanula glomerata | 6-9 |
| Moschusmalve | Malva moschata | 6-10 |
| Purpur-Waldfetthenne | Hylotelephium telephium/Sedum telephium | 7-9 |
| Quirlblättriger Salbei | Salvia vertillicata | 6-9 |
| Ross-Minze | Mentha longifolia | 7-9 |
| Sandthymian | Thymus serpyllum | 5-10 |
| Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Hahnenfuß | Ranunculus acris | 5-10 |
| Skabiosen-Flockenblume | Centaurea scabiosa | 6-9 |
| Spitzwegerich, Breitwegerich | Plantago lanceolata, Plantago major | 4-9, 6-10 |
| Tauben-Skabiose | Scabiosa columbaria | 7-10 |
| Traubenkropf-Leimkraut/Gewöhnliches Leimkraut/Klatschnelke | Silene vulgaris | 5-9 |
| Wilde Karde (2-jährig) | Dipsacus fullonum/ Dipsacus sylvestris | 7-9 |
| Wiesen-Flockenblume | Centaurea jacea | 6-10 |
| Wiesen-Witwenblume | Knautia arvensis | 6-9 |
| Wilder Majoran/Echter Dost | Origanum vulgare | 7-9 |
| Wilde Möhre (2-jährig) | Daucus carota | 6-9 |
| Wundklee | Anthyllis vulneraria | 5-9 |
| Besenheide (Kleinstrauch) | Calluna vulgaris | 7,10-11 |
| Efeu (Klettergehölz) | Hedera helix | 9-11 |
| Gewöhnliche Waldrebe (Klettergehölz) | Clematis vitalba | 6-10 |
Auswahl an herbstblühenden Gartenpflanzen und Gehölzen (alphabetisch, nicht nach Wertigkeit gereiht, kein Anspruch auf Vollständigkeit)
Deutscher Name |
Botanischer Name |
Blühmonat |
| Dahlien-Hybriden (ungefüllte Sorten) | Dahlia sp. | 7-10 |
| Echter Thymian | Thymus vulgaris | 5-10 |
| Gelber Sonnenhut | Rudbeckia fulgida u.a. | 7-10 |
| Kandelaber-Ehrenpreis | Veronicastrum virginicum | 7-9 |
| Katzenminze | Nepeta x faassenii | 5-10 |
| Kissenaster | Aster dumosus | 8-10 |
| Kugeldistel | Echinops sp. | 6-9 |
| Phlox Sorten | Phlox paniculata | 6-9 |
| Prächtige Fetthenne | Sedum spectabile | 8-9 |
| Scheinsonnenhut/Igelkopf | Echinacea sp. | 7-9 |
| Raublatt-Aster | Aster novae-angliae | 9-11 |
| Rote Spornblume | Centranthus ruber | 5-9 |
| Roter Wasserdost, Röhriger Wasserdost | Eupatorium purpureum, Eupatorium fistulosum | 7-10 |
| Sonnenbraut Sorten | Helenium sp. | 7-10 |
| Verbena-Hybriden | z.B. Patagonisches Eisenkraut (Verbena bonariensis) | 6-10 |
| Bartblume (Gehölz) | Caryopteris x clandonensis | 7-10 |
| Geißblatt Sorten (Gehölz) | Lonicera sp. | 6-9 |
| Japanischer Spierstrauch (Gehölz) | Spiraea japonica | 6-9 |
| Sieben-Söhne-des-Himmels Strauch (Gehölz) | Heptacodium miconioides | 7-10 |
| Trompetenwinde (Gehölz) | Campsis radicans | 7-9 |

Wenn Schmetterlinge nicht wie die Wanderfalter – wie z.B. Distelfalter, Postillon und Taubenschwänzchen – in den wärmeren Süden ziehen und erst in Form ihrer Nachkommen im Frühsommer zurückkehren, haben Schmetterlinge verschiedene Möglichkeiten, um den Winter in unseren Breiten zu überstehen: 1% aller Arten überwintert als Falter, 50% als Puppe, 44% als Raupe und 5% als Ei. Die ersten im Frühling auftauchenden Falter haben als fertiger Schmetterling überwintert – dazu zählen z.B. der Zitronenfalter, der Große und der Kleine Fuchs, das Tagpfauenauge, der C-Falter oder der Trauermantel.
Zitronenfalter überwintern im Schutz der Vegetation wie z.B. im Efeu und tarnen sich in der Winterstarre, indem sie einem Blatt täuschend ähnlich sehen. Die „Brennnesselfalter“ (deren Raupen gerne an Brennnessel fressen) wie Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs und C-Falter benötigen größere Hohlräume – etwa zugängliche kühle Dachböden, Scheunen oder Keller. Für diese Schmetterlingsarten ist es wichtig, im zeitigen Frühjahr regelmäßig zu lüften, damit die Falter ihr Überwinterungsquartier auch wieder verlassen können. Nach dem Erwachen brauchen sie außerdem Nahrung durch Frühlingsblüher wie Sal-Weide oder Primeln und passende Futterpflanzen für ihre Raupen.
„Unordnung“ im Garten rettet viele Leben: Die Mehrheit der Schmetterlinge überwintert jedoch als Puppe, Raupe, oder im Ei. Ihr größtes Problem sind winterliche Erd- und Schnittarbeiten an den Pflanzen, die Puppen oder abgelegte Eier beherbergen. Erst im April oder im Mai erscheinen bei uns jene Falter, die als Puppen an vertrockneten Pflanzenteilen, in Kokons eingesponnen oder im Boden eingegraben überwintern konnten und dann im Frühjahr schlüpfen. Für Aurorafalter, Schwalbenschwanz, Segelfalter und Weißlinge lassen wir vertrocknete Halme und Büschel über den Winter auf den Beeten und Laubunter Sträuchern deshalb einfach stehen bzw. liegen. Schaffen wir im Herbst in Feld, Flur und Garten zu viel Ordnung, haben Puppen wie z.B. die des Schwalbenschwanzes nämlich keine Möglichkeit, den Winter zu überstehen. Falter, die als mehr oder weniger weit entwickelte Raupe überwintern, fressen meist im Frühjahr noch weiter an ihren Nahrungspflanzen und verpuppen sich erst anschließend. Manche Raupen verkriechen sich in der Vegetation, andere bauen sich ein Überwinterungsgespinst. Einige, wie z.B. die Raupe des Schillerfalters, überwintern sogar völlig ungeschützt festgesponnen an Pflanzenteilen. Schachbrett, Bläulinge oder der Schwarze Trauerfalter zeigen sich deshalb frühestens ab Mai oder erst im Juni. Damit die Vielfalt im Frühling und Sommer in unsere Gärten flattert, ist also vor allem unser Mut zu „Unordnung“ gefragt!
Jene Falter, die in Form von Eiern überwintern – wie etwa das Rote Ordensband oder der Apollofalter – erscheinen noch später im Jahr. Die bereits ganz am Anfang des Artikels erwähnten Nachkommen der Wanderfalter wiederum, kehren nach dem Winter in unsere Breitengrade zurück, um hier die im Hochsommer fliegende, neue Wander-Generation zu zeugen. Diese wird sich dann im Herbst wieder auf die Reise nach Süden begeben. Wanderfalter treten von Jahr zu Jahr in sehr schwankender Häufigkeit auf, je nachdem, wie günstig die Einwanderungsbedingungen waren.

Traditionell waren ländliche Siedlungsräume reich strukturiert: Heckenraine mit blühenden Säumen, Obstgehölze, Nutzgärten und blütenreiche Vorgärten bildeten auf kleinem Raum mosaikartige Lebensräume und waren dadurch wahre Schmetterlingsparadiese. In der zweiten Hälfte das 20. Jahrhunderts änderte sich das Ortsbild jedoch zunehmend. Koniferen, Zwergmispel, Kriech-Spindelstrauch und Rosen, welche für unsere Schmetterlinge und deren Raupen nicht nutzbar sind, lösten die bunte Vielfalt ab. In den Städten hat die Vielfalt an heimischen Pflanzen unter anderem durch stark zunehmende Bebauungsdichte und intensivere Nutzung der Restnatur durch Erholungssuchende sowie Überdüngung durch Eintrag von Stickstoff über die Luft aber auch Belastung von Grünflächen mit Hundekot stark abgenommen. Der Verlust an heimischer Pflanzenvielfalt hat wiederum gleich eines Dominoeffekts unmittelbare Auswirkung auf zahlreiche Tierarten. Viele unserer beliebten Falter etwa, sind vor allem als Raupen von ganz bestimmten Pflanzen abhängig. Dabei spielen besonders heimische Gehölze als Nahrung für Raupen eine bedeutende Rolle – und Raupen sind nun mal die Schmetterlinge von Morgen. Geeignete Gehölze sollten deshalb sowohl im Privatgarten als auch im Gemeindegrün unbedingt vielfältig vorhanden sein, damit wir uns auch in Zukunft noch an Schmetterlingen erfreuen können.
Alle heimischen Gehölze werden von Raupen genutzt. Besonders wichtige Futterpflanzen sind (Auswahl, nicht nach Wertigkeit gereiht): Apfelbaum (Malus), Birke (Betula), Brombeere (Rubus fructicosus aggr.), Himbeere (Rubus idaeus) Eichen (Quercus, v.a. Stiel- und Trauben-Eiche), Rotbuche (Fagus sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), Geißklee (Cytisus), Ginster (Genista), Besenginster (Cytisus scoparius), Faulbaum (Rhamnus frangula), Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Haselnuss (Coryllus avellana), Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Pappeln (Populus, v.a. Zitter-Pappel), Schlehdorn (Prunus spinosa), Spiersträucher (Spiraea für Ostösterreich), Weiden (Salix, v.a. Sal- und Silber-Weide), Weißdorn (Crataegus monogyna) und Zwerggeißklee (Chamaecytisus).
Unter den Bäumen gibt es für Falter außer den im Frühling blühenden Kern- und Steinobstverwandten sowie Weiden (v. A. Sal-Weide!) kaum als Nektarlieferanten in Frage kommende Arten. Lediglich die Blüten der heimischen Linden (Tilia) haben für Nachtfalter mäßige Bedeutung. Bei den Lianen sind es die meisten Arten des auch als Jelängerjelieber (Lonicera xylosteum) bekannten Geißblatts, die für Nachtfalter bedeutsam sind. Auch Efeu (Hedera helix) wird von Faltern wie etwa dem Admiral oder dem Tagpfauenauge besucht.
Einige heimische Sträucher sind von hoher bis mittlerer Bedeutung als Nektarquelle für Falter (Auswahl, nicht nach Wertigkeit gereiht): Schlehdorn (Prunus spinosa), Brombeere (Rubus fructicosus), Himbeere (Rubus idaeus), Liguster (Ligustrum) oder Schwarzer Holunder (Sambucus niger). Weitere, jedoch nicht heimische Ziersträucher, die von Schmetterlingen besucht werden, sind u. A.: ungefüllter Flieder (Syringa), Kamm-Minze/Chinesischer Gewürzstrauch (Elsholtzia stauntonii), Mönchspfeffer (Vitex agnus-castus) und Schönfrucht/Liebesperlenstrauch (Callicarpa bodinieri).
Spezialfall „Schmetterlingsflieder“
Im Zusammenhang mit nektarreichen Gehölzen für Schmetterlinge wird häufig der Sommerflieder genannt. Der Gewöhnliche Sommerflieder (Buddleja davidii) ist jedoch ein nicht zu unterschätzender, invasiver Neophyt. Aufgrund der starken Ausbreitungstendenz und der damit einhergehenden Verdrängung heimischer Pflanzenarten, ist auf die Pflanzung solcher invasiven Arten unbedingt zu verzichten. Im „Natur im Garten“ Infoblatt „Neophyten-neue Pflanzen“ findest du entsprechende Informationen zu diesem Thema kostenlos zum Download: www.naturimgarten.at/infoblaetter. Für alle, die auf Sommerflieder nicht verzichten wollen, gibt es gute Nachrichten: es gibt bereits sterile Sorten sowie andere Arten und Hybriden im Handel, die keine Tendenz zur invasiven Ausbreitung haben. Eine Auswahl findest du im „Natur im Garten“ Blog unter https://blog.naturimgarten.at/detailseite/pflanzen-2765.html. Doch wie immer gilt: in einer guten Mischung für unsere heimische Tierwelt sollten heimische Pflanzen immer in der Überzahl vorhanden sein.
Unser Tipp für eine Artenreiche Hecke:
Frisch bis feuchter Standort:
Sal-Weide (Salix caprea), Faulbaum (Rhamnus frangula), Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Spierstrauch (Spiraea)
Frisch bis trockener Standort:
Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Schlehdorn (Prunus spinosa), Weißdorn (Crataegus monogyna), Liguster (Ligustrum vulgare), Haselnuss (Corylus avellana), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Kaskaden-Sommerflieder (Buddleja alternifolia), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), Attich (Sambucus ebulus)
Jetzt im Herbst ist die beste Pflanzzeit für Gehölze. Verzichte auf Thuje und Kirschlorbeer, es liegt an dir, die richtigen Hecken für Schmetterlinge & Co zu checken! Unterstützung bei der Auswahl von ökologisch wertvollen Hecken findest du beim Heckennavigator unter www.willheckehaben.at. Auch unsere „Natur im Garten“ Partnerbetriebe helfen dir gerne mit fachkompetenter Beratung bei der Pflanzenauswahl: www.naturimgarten.at/partnerbetriebe
Du willst mehr Schmetterlingswissen? - Herzlich hereingeflattert in die bunte Schmetterlingswelt!
Wenn du dich noch genauer mit der heimischen Schmetterlingsweltbefassen möchtest, dann empfehlen wir dir die Schmetterlingsapp von Blühendes Österreich. Die App zum Citizen Science Projekt „Schmetterlinge Österreichs“ steht in den App-Stores von Apple und Android zur kostenlosen Verfügung. Auf www.schmetterlingsapp.at gibt es außerdem auch eine Desktopversion. Be part of it - vernetze dich mit DER Schmetterlings-Community Österreichs!

Der Herbst ist jene Jahreszeit, welche sich neben der Pflanzung von Stauden, Gehölzen und Bäumen auch perfekt dafür eignet, um Frühlingsblüher wie Tulpe, Narzissen und Krokus in den Garten zu pflanzen. Doch welche Zwiebel- und Knollenpflanzen eignen sich eigentlich wirklich, um Schmetterlingen und deren Raupen eine Nahrungsgrundlage zu bieten?
Raupen
Nur wenige Schmetterlingsraupen leben an Zwiebel oder Knollenpflanzen. Einzig nennenswert sind die knolligen Lerchensporn-Arten Corydalis solida, Corydalis cava und Corydalis. intermedia. Sie sind Futterpflanzen des Schwarzen Apollo, der nur in Buchenwaldgebieten vorkommt. Im Sommer vollschattige Standorte unter sommergrünen Gehölzen mit größeren Beständen einer der Lerchensporn-Arten können eventuell auch im Garten Raupen des Schwarzen Apollo beherbergen, falls der Garten nahe eines Buchenwaldes mit einer Restpopulation des seltenen Falters liegt.
Schmetterlinge
Schneeglöckchen, Märzenbecher, Blausterne oder Traubenhyazinthen werden hie und da von Tagfaltern besucht. Sonst gibt es unter den vielen Frühlingsgeophyten kaum für Schmetterlinge geeignete Arten als Nektarquelle. Lediglich Dichter-Narzisse (Narcissus poeticus) und Tazetten (Narcissus tazetta) sind Nachtfalterblumen. Sommerblühende Knollenpflanzen, welche aber nicht winterhart sind, mit guter Eignung für Falter sind Lilien (Lilium), ungefüllte Dahlien, Stern-Gladiole (Gladiolus callianthus) und Wunderblume (Mirabilis jalapa). Die immer wieder in Schmetterlingsmischungen angebotenen roten Montbretien sind dagegen völlig ungeeignet für Schmetterlinge. Die hier überwinternden Falter, wie C-Falter, Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge, Zitronenfalter und mittlerweile mancher Admiral suchen in den ersten Frühlingstagen aber dringend und hungrig nach verfügbaren Nektarquellen. Diese finden sie statt an den bunten Zwiebel- und Knollenpflanzen an eher unscheinbaren Blüten. Unersetzliche Schmetterlingstankstellen für aufwachende Falter sind nämlich in erster Linie die Palmkätzchen der weiblichen Sal-Weiden (die männlichen Blüten haben vor allem Pollen). Auch der Echte Seidelbast (Daphne mezereum) hält Nahrung im zeitigen Frühjahr parat. Nicht heimisch und damit auf Winterschutz angewiesen ist der Japanische Papierbusch (Edgeworthia chrysantha), der dafür aber wenn er im zeitigen Frühjahr blüht, für alle „Winterfalter“ einen reich gedeckten Tisch bieten kann.
Vor allem Kräuterrasen, Heckensaum und Wegesrand helfen Faltern und vielen anderen Insektenarten mit typischen, heimischen Frühlingsblühern wie Huflattich, Veilchen, Primel, Leberblümchen, Löwenzahn, Günsel, Gundermann, Lungenkraut, Frühlingsplatterbse, Schlüsselblumen Gänseblümchen und vielen mehr dabei, ihre Energiereserven wieder voll zu tanken. Die besten Falterblumen für den Frühling sind also weniger die bunten und teils pompösen Frühlingsgeophyten wie Tulpen oder Narzissen, sondern vielmehr die hübschen, zarten Blütentupfer unserer heimischen Pflanzenwelt.
Unsere „Natur im Garten“ Partnerbetriebe bieten ein umfangreiches Sortiment und unterstützen dich gerne mit fachkompetenter Beratung bei der Pflanzenwahl: www.naturimgarten.at/partnerbetriebe

In der kühleren Jahreszeit kommt die Gartenarbeit langsam zur Ruhe. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um sich über die Neugestaltung, Erweiterung bzw. Ergänzung des Gartens und der Pflanzen darin Gedanken zu machen. Mit geeigneter Pflanzenwahl und dem Anlegen von Naturgartenelementen kann dabei aktiv Umweltschutz vor der eigenen Haustüre betrieben werden. Mit der richtigen Mischung aus nektarreichen Blütenpflanzen wird Ihr Garten dabei zum Paradies für Schmetterlinge.
Neben der richtigen Bepflanzung ist es für ein Schmetterlingsparadies auch wichtig, den Schmetterlingen eine kleine Wasserlacke einzurichten, welche einen leicht schlammigen Untergrund hat. Die Falter können so mit dem Wasser wichtige Mineralien aufnehmen, welche sie zum Überleben brauchen. Zusätzlich wird solch eine Wasserlacke auch für andere Insekten insbesondere in der trockenen Sommerzeit eine willkommene Tränke bieten. Auch an Rastplätze für die bunten Gaukler sollte gedacht werden. Dazu eignen sich vertikal aufgestellte Baumstämme oder andere Biotop-/Totholzelemente sehr gut. Tagfalter benötigen nämlich vor allem morgens sonnige, freie Plätze zum Aufwärmen, um auf „Betriebstemperatur“ zu kommen. Integriert ins Staudenbeet, sind diese nicht nur ökologisch wertvoll sondern bilden auch hübsche Gestaltungselement. Werden die Baumstämme noch zusätzlich sauber und glatt mindestens 10 cm tief in verschiedenen Lochgrößen von 2 bis 9 mm (das Ende des Bohrlochs soll dabei geschlossenem bleiben) angebohrt, finden auch viele Wildbienenarten Nistplätze im Garten. Für manche Schmetterlingsarten sind solche Baumstämme nicht nur wichtige Rastplätze, sondern dienen, wenn sie das höchste Element in der Umgebung sind, zugleich als Rendezvousplatz für die Balz.
Auswahl an Pflanzenempfehlungen für ein Schmetterlingsparadies
SONNIGE STANDORTE
Sträucher: grünblättriger Zierapfel (Malus), Liguster (Ligustrum vulgare), Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Sal-Weide (Salix caprea), Kaskaden-Sommerflieder (Buddleja alternifolia)
Unterpflanzung: Traubenhyazinthe (Muscari neglectum), Veilchen (Viola odorata)
Stauden: Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Acker-Witwenblume (Knautia arvensis), Echtes Labkraut (Galium verum), Kartäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum), Bartnelke (Dianthus barbatus), Wilde Karde (Dipsacus fullonum), Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare), Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum), Gewöhnliche Hornklee (Lotus corniculatus), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Kissen-Aster (Aster dumosus), Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum), Wolfsmilch (Euphorbia), Flammenblume (Phlox), Lilien (Lilium)
Kletterpflanzen: Brombeere (Rubus), Jelängerjelieber (Lonicera caprifolium)
Kräuter: Thymian (Thymus), Salbei (Salvia), Gewürzfenchel (Foeniculum), Oregano (Origanum)
SCHATTIGE STANDORTE
Sträucher: Faulbaum (Rhamnus frangula), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Weißdorn (Crataegus monogyna), Liguster (Ligustrum vulgare) Unterpflanzung: Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata), Veilchen (Viola odorata), Gefingerter Lerchensporn (Corydalis solida), Türkenbund (Lilium martagon)
Stauden: Wald-Phlox (Phlox divaricata), Wald-Geißbart (Aruncus dioicus), Frühlings-Platterbse (Lathyrus vernus), Wald-Zwenke (Brachypodium sylvaticum), Nickendes Perlgras (Melica nutans), Veilchen (Viola odorata)
Kletterpflanzen: Brombeere (Rubus), Efeu (Hedera helix)
Kräuter: Minze (Mentha), Brennnessel (Urtica dioica)
Unsere „Natur im Garten“ Partnerbetriebe bieten ein umfangreiches Sortiment und unterstützen dich gerne mit fachkompetenter Beratung bei der Pflanzenwahl: www.naturimgarten.at/partnerbetriebe
Übrigens noch abschließend eine ganz wichtige Botschaft für den Herbst: Aufräumen im Garten ist lebensbedrohlich! Die meisten unserer heimischen Schmetterlinge überwintern als Ei, Raupe oder Puppe unter anderem an vertrockneten Pflanzenstängeln oder Sträuchern. Wer im Herbst in den Stauden- und Blumenbeeten und Nischen alles fein säuberlich abräumt und die Hecken schneidet, vernichtet diese Überwinterungsformen. All die gut für den Winter vorbereiteten, unscheinbar verborgenen Schmetterlinge, flattern dann im kommenden Jahr nicht mehr durch unsere Gärten. Wilde Ecken im Garten und ein Verzicht auf solche „Hauruck-Aufräumaktionen“ helfen unseren wunderschönen Faltern beim Überleben und sparen wertvolle, eigene Lebenszeit.

Über Jahrtausende hat sich die hier heimische Insektenwelt an die in unseren Breitengraden vorkommende Pflanzenwelt angepasst. Vor allem Schmetterlinge sind hier besonders, denn die Raupen der Falter bevorzugen je nach Art ganz bestimmte Pflanzenarten als Raupenfutter. So würde z.B. die Raupe eines Tagpfauenauges, diese brauchen Brennnesseln, niemals die Blätter eines Kreuzdorns fressen. Kreuzdorn und Faulbaum sind hingegen die einzigen Nährgehölze für die Zitronenfalterraupe. Manche Schmetterlingsraupen fressen sogar nur an einer einzigen Pflanzenart und wenn es die nicht gibt, verschwindet auch die Falterart. Um so viele heimische Arten wie möglich zu fördern, sollte eine gute Mischung an ökologisch wertvollen Wildgehölzen deshalb sowohl im Garten als auch im Gemeindegrün nicht fehlen. Unterstützung bei der Auswahl von Hecken oder Bäumen für Privatgärtnerinnen und Privatgärtner sowie Gemeinden bieten zwei innovative, kostenlose Online-Tools von „Natur im Garten“: der Heckennavigator www.willheckehaben.at und der Baumnavigator www.willbaumhaben.at.
Alle heimischen Gehölze werden von Raupen genutzt. Besonders wichtige Futterpflanzen sind (Auswahl, nicht nach Wertigkeit gereiht): Apfelbaum (Malus), Birke (Betula), Brombeere (Rubus fructicosus aggr.), Himbeere (Rubus idaeus) Eichen (Quercus, v.a. Stiel- und Trauben-Eiche), Rotbuche (Fagus sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), Geißklee (Cytisus), Ginster (Genista), Besenginster (Cytisus scoparius), Faulbaum (Rhamnus frangula), Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Haselnuss (Coryllus avellana), Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Pappeln (Populus, v.a. Zitter-Pappel), Schlehdorn (Prunus spinosa), Spiersträucher (Spiraea für Ostösterreich), Weiden (Salix, v.a. Sal- und Silber-Weide), Weißdorn (Crataegus monogyna) und Zwerggeißklee (Chamaecytisus).
Unter den Bäumen gibt es für Falter außer den im Frühling blühenden Kern- und Steinobstverwandten sowie Weiden (v. A. Sal-Weide!) kaum als Nektarlieferanten in Frage kommende Arten. Lediglich die Blüten der heimischen Linden (Tilia) haben für Nachtfalter mäßige Bedeutung. Bei den Lianen sind es die meisten Arten des auch als Jelängerjelieber (Lonicera xylosteum) bekannten Geißblatts, die für Nachtfalter bedeutsam sind. Auch Efeu (Hedera helix) wird von Faltern wie etwa dem Admiral oder dem Tagpfauenauge besucht und gerne einmal als Nachtruhe- oder Überwinterungsplatz, z.B. vom Zitronenfalter, genutzt.
Einige heimische Sträucher sind von hoher bis mittlerer Bedeutung als Nektarquelle für Falter (Auswahl, nicht nach Wertigkeit gereiht): Schlehdorn (Prunus spinosa), Brombeere (Rubus fructicosus), Himbeere (Rubus idaeus), Liguster (Ligustrum) oder Schwarzer Holunder (Sambucus niger). Weitere, jedoch nicht heimische Ziersträucher, die von Schmetterlingen besucht werden, sind u. A.: ungefüllter Flieder (Syringa), Kamm-Minze/Chinesischer Gewürzstrauch (Elsholtzia stauntonii), Mönchspfeffer (Vitex agnus-castus) und Schönfrucht/Liebesperlenstrauch (Callicarpa bodinieri).
Spezialfall „Schmetterlingsflieder“ - Wie Schmetterlingsspezialist und Falterliebhaber Michael Altmoos sehr passend formulierte: „Auweia Buddleja“
Im Zusammenhang mit nektarreichen Gehölzen für Schmetterlinge wird häufig der Sommerflieder genannt. Der Gewöhnliche Sommerflieder (Buddleja davidii) ist jedoch ein nicht zu unterschätzender, invasiver Neophyt. Aufgrund der starken Ausbreitungstendenz und der damit einhergehenden Verdrängung heimischer Pflanzenarten, ist auf die Pflanzung solcher invasiven Arten unbedingt zu verzichten. Im „Natur im Garten“ Infoblatt „Neophyten-neue Pflanzen“ finden Sie entsprechende Informationen zu diesem Thema kostenlos zum Download: www.naturimgarten.at/infoblaetter. Für alle, die auf Sommerflieder nicht verzichten wollen, gibt es gute Nachrichten: es gibt bereits sterile Sorten sowie andere Arten und Hybriden im Handel, die keine Tendenz zur invasiven Ausbreitung haben. Eine Auswahl findest du im „Natur im Garten“ Blog unter https://blog.naturimgarten.at/detailseite/pflanzen-2765.html. Doch wie immer gilt: in einer guten Mischung für unsere heimische Tierwelt sollten heimische Pflanzen immer in der Überzahl vorhanden sein.
Unser Tipp für eine Artenreiche Hecke:
Frisch bis feuchter Standort:
Sal-Weide (Salix caprea), Faulbaum (Rhamnus frangula), Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Spierstrauch (Spiraea)
Frisch bis trockener Standort:
Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Schlehdorn (Prunus spinosa), Weißdorn (Crataegus monogyna), Liguster (Ligustrum vulgare), Haselnuss (Corylus avellana), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Kaskaden-Sommerflieder (Buddleja alternifolia), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), Attich (Sambucus ebulus)
Unsere „Natur im Garten“ Partnerbetriebe bieten ein umfangreiches Sortiment und unterstützen dich gerne mit fachkompetenter Beratung bei der Pflanzenwahl: www.naturimgarten.at/partnerbetriebe

Gerade naturnahe Schulgärten die ohne chemisch-synthetische Pestizide, Kunstdünger und Torf gepflegt und gestaltet werden, sind heute sehr wichtige Rückzugsorte für Schmetterlinge und andere Insekten. Mit einer geschickten Auswahl an Pflanzen und einfachen Gestaltungen, können die schönen und interessanten Tiere angelockt und gezielt gefördert werden. Ein reiches Nektarangebot zum Beispiel, lockt die Schmetterlinge in den Garten. Vor allem rötliche bis violette Blüten und ein süßer Duft sind bei Tagfaltern beliebt. Nachtfalter hingegen bevorzugen helle Blüten. Optimal sind Kräuterbeete und Staudenbeete mit einfachen, ungefüllten Blüten – das heißt Blüten, in deren Mitte sich für Insekten leicht zugänglich die Staubblätter mit nahrhaftem Pollen und Nektar finden. Die Raupen, aus denen ja letztlich die Schmetterlinge werden, werden leider häufig vergessen oder sogar bekämpft. Schmetterlinge sind aber nur dort zu Hause, wo es auch Futter für die Raupen gibt. Häufig sind unscheinbare Blütenpflanzen oder Sträucher für die Raupen wichtige oder unerlässliche Nahrungsquellen, wie beispielsweise der Hornklee oder der Faulbaum. Wer heute im Garten eine wilde Ecke mit Brennnesseln zulässt, an der rund 50 Schmetterlingsraupen fressen, betreibt aktiven Artenschutz!
Im Schulgarten und der Gartenpädagogik können Wiesenbereiche, Wildstrauchhecken und andere Natur(garten)elemente gezielt im Unterricht genutzt werden, um den Schülerinnen und Schülern die Wichtigkeit der Natur näher zu bringen. Das Beobachten der fressenden Raupen und die bunten Farben der Schmetterlinge können in Kindern großes Interesse wecken und schon in jungen Jahren das Verständnis für Naturkreisläufe fördern sowie die Liebe zur Natur wachsen lassen. Die Kinder können beispielhaft lernen, dass wilde Ecken nicht unordentliche, sondern sehr wertvolle Bereiche im Garten sind und vermeintlich unscheinbare, heimische Pflanzen eine wichtige Lebensgrundlage für die Insektenwelt darstellen. Vor allem transportieren sie das Gelernte und insbesondere das erlebte Wissen, dass aus jeder Raupe ein Schmetterling wird und was es dazu braucht, auch aktiv in ihr soziales Umfeld und werden so begeisterte Botschafterinnen und Botschafter für die Natur
Was passt nun in so einen schmetterlingsfreundlichen Schulgarten?
Da gibt es zum Beispiel eine Vielzahl an Blütenstauden für sonnige Standorte, auf deren Nektarreichen Blüten Schmetterlinge gut zu beobachten sind. Dies wären Flockenblume, Witwenblume, Labkraut, Kartäuser Nelke, Wilde Karde, Natternkopf, Herbstaster, Echtes Johanniskraut, Hornklee und Wiesen-Salbei.
Kräuter lassen sich nicht nur gut verarbeiten, ihre Blüten sind ein wahrer Anziehungspunkt. Zu den beliebtesten gehören Thymian, Salbei, Schnittlauch, Dill und Oregano. Die Blätter der Brennnessel und des Gewürzfenchels wiederum sind ein wichtiges Raupenfutter. Gerade am Fenchel oder am Karottengrün lassen sich oft die farbenprächtigen Raupen des Schwalbenschwanzes beobachten.
Für schattige Standorte empfehlen wir den gefiederten Lerchensporn, Waldphlox, Wald-Geißbart, Glockenblume, Waldmeister, Frühlings-Platterbse.
Aber auch Gehölze dürfen in einem Schulgarten nicht fehlen. Sie dienen vielen Faltern und ihren Raupen als Nahrung oder als Platz zum Überwintern und es lassen sich an diesen die Jahreszeiten sehr gut ablesen. Hier empfiehlt „Natur im Garten“ z.B. Zierapfel, Liguster, Salweide, Haselnuss und Hartriegel. Als Kletterpflanzen sind Brombeeren und Efeu bei Schmetterlingen sehr beliebt. In so einem Schulgarten gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, um Kindern und Jugendlichen Erlebnis- und Lernraum zu bieten und dabei gleichzeitig Arten- und Klimaschutz zu betreiben. Wenn du gerne ein Beispiel für so einen naturnahen Schulgarten ansehen und erleben möchtest, dann komm gerne in unseren „Natur im Garten“ Musterschulgarten!
Hereingeflattert in den „Natur im Garten“ Musterschulgarten – dem Garten zum Lernen, Lehren und Leben!
Der „Natur im Garten“ Muster-Schulgarten auf der GARTEN TULLN kann in der Saison von April bis Oktober besucht werden. Er bietet mit Grünem Klassenzimmer, Gemüse- und Hochbeeten, Naschhecken und zahlreichen Naturgartenelementen einen ansprechenden Raum für einen handlungsorientierten Unterricht und bewegte Pausen an der frischen Luft. Hier können Schülerinnen und Schüler mit allen Sinnen lernen und das nicht nur in Biologie und Sachunterricht! Nähere Infos dazu findest du unter: www.naturimgarten.at/schulgarten
Schau gerne auch jederzeit online auf die kostenlose Lernplattform „Lernen im Garten“. Dort findest du Methoden für das Lernen im Garten, didaktische Materialien, kostenlose Downloads und weiterführende Links zu verschiedenen Themenbereichen rund um das ökologische Gärtnern.
Bis Ende 2023 hat „Natur im Garten“ für Schulen und Kindergärten in Niederösterreich auch noch eine tolle AKTION: die kostenlose Auszeichnung mit der beliebten „Natur im Garten“ Igel-Plakette! Diese Zertifizierung steht für naturnahen Lebensraum, welcher frei von chemisch-synthetischen Pestiziden und Kunstdünger sowie umweltbewusst ohne den Einsatz von Torf bewirtschaftet, gestaltet und gepflegt wird. Die Umweltbewegung „Natur im Garten“ begleitet Bildungseinrichtungen gerne am Weg zur Auszeichnung mit der „Natur im Garten“ Plakette und steht dabei beratend zur Seite. Genaue Infos findest du hier: www.naturimgarten.at/plakette-schule-kiga

Die Paarung: Durch Pheromone (Duftstoffe), finden Männchen und Weibchen der jeweiligen Schmetterlingsart zusammen und beginnen mit dem Liebesflug, der auch Balz genannt wird. Nach einiger Zeit verbinden sich die Hinterleiber der Schmetterlinge. Das Weibchen nimmt ein Samenpaket des Männchens auf, welches im Körper des Weibchens die Eier befruchtet.
Das Ei: Die Eier werden zumeist direkt auf den geeigneten Raupenfutterpflanzen abgestreift. Viele Arten legen diese aber auch in Beständen der Futterpflanze auf den Boden, entweder weil die Raupen im Boden leben oder die Futterpflanze ihre Vegetationsperiode schon abgeschlossen hat und unterirdisch überdauert (Beispiel: Schmetterlingsart - Schwarzer Apollo, Raupenfutterpflanze - Lerchensporn). Der Kaisermantel legt seine Eier in 1–4 m Höhe an Baumstämmen ab, die von Futterpflanzen (Veilchen) umgeben sind, der Mauerfuchs nur an regengeschützten Grashalmen, etwa unter überhängenden Steinen. Viele Arten sind auf lockere Vegetation im Raupenstadium angewiesen und kommen deshalb trotz passender Futterpflanzen nicht in gedüngten Fettwiesen vor. Segelfalter benötigen Steinobst der Pflaumenverwandtschaft (Schlehe, Pflaume, Marille, Pfirsich) über möglichst kahlem Boden. Blutpflaumen werden ihm aufgrund der roten Blattfarbe zum Verhängnis: die blitzgrünen Raupen sind auf den roten Blättern sehr gut sichtbar und werden infolgedessen zu hundert Prozent Vogelfutter. Die meisten Brennnesselfalter sind auf dichte Bestände angewiesen, wobei Beschattung und Luftfeuchtigkeit eine große Rolle spielen. So benötigen Landkärtchen Vollschatten, das Tagpfauenauge hohe Luftfeuchtigkeit am besten am Gewässerrand, nur der Admiral liebt einzelnstehende Brennnesseln in voller Sonne.
Die Raupen: Nach wenigen Tagen, schlüpfen die Raupen, nachdem sie sich durch die Eihülle gefressen haben. Ihr Lebenszweck besteht darin zu fressen und zu wachsen. Sie häuten sich im Laufe der Entwicklung einige Male und verändern dabei auch des Öfteren ihr Aussehen. Um sich vor Fressfeinden zu schützen, sind viele Raupen grün oder braun, um sich gut im Dickicht von Blättern tarnen zu können. Einige Arten nehmen Gifte ihrer Futterpflanzen auf und zeigen auffällig bunte Warnfarben, oder tragen giftige Haare an der Körperoberfläche, damit sie von Beutegreifern verschont bleiben.
Die Puppe: Ist die Raupe bereit sich zu verpuppen, sucht sie sich einen geeigneten Platz, um sich dort in Ruhe vollständig verwandeln zu können. Raupen verpuppen sich selten an der Futterpflanze. Sie suchen dafür meist geschützte Plätze auf. Viele Nachtfalter verpuppen sich in lockerem Erdreich. Spinnerraupen spinnen sich vor der Verpuppung in einen schützenden Kokon ein. Tagfalter bevorzugen dichte Gehölze in der Umgebung der Futterpflanzen. Die Verpuppungsmethoden sind je nach Art unterschiedlich, einige hängen sich kopfüber von Zweigen (Sturzpuppe), spinnen einen Gürtel (Gürtelpuppe) der sie senkrecht hält, oder verpuppen sich in einem Kokon. Bei der Verpuppung platzt die Raupenhaut auf und die Puppe kommt zum Vorschein. Die Organe werden durch Enzyme zersetzt – die Raupe löst sich also sozusagen auf - und der Schmetterling wird ganz neu gebildet. Der faszinierende Umbau dauert etwa zwei Wochen, wobei 50% der Arten auch als Puppe überwintern und dadurch länger im Puppenstadium bleiben.
Der Schlupf: Ist die Metamorphose abgeschlossen, bricht die starre Hülle der Puppe auf und der Falter beginnt zu schlüpfen. Hat er es aus der Puppe geschafft, verweilt er noch einige Zeit an der Stelle und pumpt „Blut“ (Hämolymphe) in seine Flügel, um diese zu entfalten und vollständig zu trocknen.
Der Falter: Der erwachsene Falter ernährt sich – wenn überhaupt – von Blütennektar, Frucht- oder Baumsäften. Er hat eine Lebenserwartung von einigen Tagen bis Monate. Manch erwachsener Schmetterling hat keine oder nur verkümmerte Mundwerkzeuge (z.B. das Nachtpfauenauge oder der Frostspanner). Sein Zweck dient rein der Paarung und der Eiablage, nach einigen Tagen verhungern diese Falter. Schmetterlinge dienen zahlreichen Tierarten als Nahrung und haben unterschiedliche Tricks zum Überleben entwickelt. Während sich einige mit Brauntönen geschickt tarnen, setzen andere auf Schreckfarben oder ahmen mit ihren schillernden Farben und Augenflecken große Tieraugen nach.
Wenn Sie mehr über Schmetterlinge lernen, sich mit den einzelnen Arten näher beschäftigen und diese bestimmen möchten, dann ist die kostenlose Schmetterlingsapp der Stiftung Blühendes Österreich genau das Richtige für Sie: www.schmetterlingsapp.at

Garten, Terrasse und Balkon in der Dämmerung zu genießen, dazu braucht es die Blaue oder Goldene Stunde. Während Rot durch die Nacht geschluckt wird, trumpfen zwischen 9.000 und 12.000 Kelvin Farbtemperatur viele Abendpflanzen mit den Farben des Mondlichts auf: Oft weiß, silbern und hellgelb reflektieren sie auch noch den kleinsten Lichtstrahl, der auf sie fällt. Das macht sie auch für andere Augen als die menschlichen attraktiv. Denn Facettenaugen wissen, dass sie hier spätabends mit Nahrung belohnt werden. Kolibriartig schnell unterwegs sind Schwärmer, die Hummelschwärmer früher, die Taubenschwänzchen später. Eulenfalter sind im Gegensatz dazu langsam. Zu den klassischen Nachtfalterblumen zählen etwa Jelängerjelieber (Geißblatt), einige Lichtnelkenarten, Linden, Nachtkerzen, Prunkwinden, Wunderblumen und Zaunwinde. Auch zahlreiche Tagfalterblumen, wie Bart-Nelke, Mondviole, Nachtviolen, Phlox oder Sommerflieder, duften nachts stärker und sind deshalb sowohl für Tag- als auch Nachtfalter interessant. Weit mehr Pflanzenarten als Sie vielleicht gedacht haben, zählen zu den Königinnen der Nacht, denen Sie einmal im Mondschein begegnet sein sollten. Das einzigartige Schauspiel “Garten bei Nacht” findet jedoch nur statt, wenn wir darauf achten, die Beleuchtung auf das notwendigste Minimum zu reduzieren und so dafür sorgen, dass Lichtverschmutzung verhindert wird.
Eine ideale Randerscheinung in Blumenbeeten sind die grünlichen kecken Zipfel der einjährigen Reseden (Reseda odorata). Ihre Schwester, die Weiße Reseda (R. alba) ist als Dauerblüher doppelt so groß und macht im Prachtstaudenbeeten mehr Eindruck. Die nächtens wunderbar duftende Reseda dankt das Vorziehen auf der warmen Fensterbank.
Die wohl schönsten Düfte der Nacht aber liefern Levkojen und Nachtviolen. Levkojen (Matthiola incana) gehörten früher zur Ausstattung jedes Bauerngartens.
Als Sommerblume ist die Nachtviole (Hesperis matronalis) eine kleine Heimlichtuerin, die tagsüber mit ihren einfachen weißen oder lila Blüten wenig auffällt. Abends aber verwandelt sie sich in eine Königin der Düfte, die einen Platz in der Nähe der Terrasse wahrlich verdient.
Am Abend verwandelt sich auch die Nachtkerze (Oenothera odorata) zur Majestät. Besonders verlockend wirkt sie in nächtlichen Stunden auf verschiedene Nachtfalter. Das Öffnen ihrer mondlichtgelben Blüten, bei dem sich ein Blütenblatt nach dem anderen aufrollt, ist ein Spektakel. Nur für eine Nacht öffnet sich auf diese Weise jede einzelne Blüte, um zitronenartigen, fruchtigen Wohlgeruch zu verströmen. Tag darauf sind die nächsten Blüten am bis zu einem Meter hohen Blütenstiel an der Reihe. Lässt man die Samen gewähren, so freuen sich samenfressende Vögel im Herbst und Sie selbst sich auf die eine Fortsetzung des Blütenreigens im übernächsten Jahr.
Farbe und Duft bringen Flammenblumen in den Garten. Von honigsüß, über Veilchen bis hin zu Kräuteraroma, ist das Geruchserlebnis umso stärker, je wärmer es ist. Phlox paniculata »Pax« ist fast krankheitsfrei und entfaltet sein Odeur am stärksten in heißen Vorabendstunden. Phlox divaricata `Clouds of Perfume´ ist eine schöne, hellblau blühende Sorte, Phlox divaricata `White Perfume´ weiß mit zierlicherem Wuchs für den Halbschatten. Auch Lilien sind auf Nachtfalter angewiesen und duften deshalb auch noch zu später Stunde betörend bis narkotisch süß, wie etwa Königs-Lilie (Lilium regale) und Madonnen-Lilie (L. candidum).

Das Wort Schmetterling hat sich erst Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts im Allgemeinen durchgesetzt. Davor wurde die Insektenordnung der Schmetterlinge als „Tagvögel“ (für Tagfalter) oder „Nachtvögel“ (Nachtfalter) benannt. Belegt wird die deutsche Bezeichnung „Schmetterling“ jedoch schon Anfang des 16. Jahrhunderts. Sie stammt vom mitteldeutschen Wort Schmetten (Rahm) ab, welches sich vom tschechischen Wort Smetana (Rahm, Obers) herleitet. Die Benennung stützt sich auf den alten Volksglauben, dass sich Hexen in der Nacht zu Schmetterlingen verwandeln, um an frischen Rahm/Obers zu gelangen und diesen zu stehlen. Dies beruht auch darauf, dass einige Schmetterlingsarten von Rahm/Obers angezogen werden. Regional wurde der Schmetterling auch als Buttervogel bezeichnet, was in die Richtung des englischen „butterfly“ geht.
Aber nicht nur Rahm/Obers schmeckt manchen Schmetterlingen besonders gut, auch überreifes Obst hat es ihnen angetan. Nicht selten können Tagpfauenauge oder Admiral auf faulenden Zwetschken beobachtet werden. Auch die durch den Lichteinfall wunderschön farbwechselnden Schillerfalter lieben faulendes Obst (zur Flugzeit meist Kirschen) und bevorzugen die Obst-Bar sogar gegenüber Blüten. Die Schmetterlinge sitzen auf dem Obst und nehmen mit ihrem langen Rüssel die gärenden Säfte zu sich, egal ob die Frucht noch am Baum hängt oder schon am Boden liegt. Aufmerksamen Beobachtern ist dies vielleicht das ein oder andere Mal schon aufgefallen. Auch wenn fauliges Obst in der Wiese für uns Menschen nicht überall erwünscht ist, so dient es doch als wertvolle Nahrungsgrundlage für einige Schmetterlingsarten. In diesem Sinne sollten wir den schönen Faltern da und dort eine kleine Fallobst-Bar im Garten belassen.
Ganz besondere Flächen für Schmetterlinge und andere Insekten mit Hang zur „Barfly“ sind Streuobstwiesen, die einst zur Versorgung mit Obst für den Menschen und Heu für das Vieh schonend bewirtschaftet wurden. Der einzigartige Landschaftscharakter des Mostviertels beruht auf dieser traditionsreichen Form der Bewirtschaftung. Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten, von Menschenhand geprägten Lebensräumen Mitteleuropas. Aufgrund der geringeren Wirtschaftlichkeit gegenüber intensiv bewirtschafteten Obstplantagen, welche maschinell beerntet werden können, ist in den letzten Jahrzehnten ein starker Rückgang von Streuobstwiesen zu beobachten. Um den gänzlichen Verlust dieser wertvollen Kulturlandschaft zu verhindern, wurde der Streuobstanbau Ende 2022 im österreichischen UNESCO-Büro zur Anerkennung als Immaterielles Kulturerbe eingereicht. Die besondere Bewirtschaftungsweise, die blühende Wiesen und Obstbau auf einer Fläche vereint, macht diese Lebensräume für unsere Schmetterlinge besonders wertvoll.
Detaillierte Informationen zum Thema Streuobstwiese finden Sie unter: www.bluehendesoesterreich.at/naturmagazin/streuobstwiesen-retten
Wenn sie mehr über Schmetterlinge erfahren möchten, dann empfehlen wir Ihnen einen Blick in die „Natur im Garten“ Broschüre „Schmetterlinge entdecken & fördern“ unter: www.naturimgarten.at/broschueren sowie auf die Website der Stiftung Blühendes Österreich mit zahlreichen, spannenden Schmetterlingsartikeln www.bluehendesoesterreich.at

Gerade im Hochsommer sind die meisten unserer 4.000 Schmetterlingsarten aktiv und können so, je nach Wetter und Flugzeit wunderbar beobachtet werden.
1 x 1 der Schmetterlingsbeobachtung
- Gutes Wetter bietet die besten Voraussetzungen, um Schmetterlinge beobachten zu können. An einem warmen, trockenen, sonnigen und windstillen Tag flattern bestimmt ein paar hübsche Exemplare beim Spazierengehen an Ihnen vorbei.
- Im Siedlungsgebiet sind naturnahe Parks, blütenreiche Grünflächen oder Kleingartensiedlungen gute Orte für die Schmetterlingsbeobachtung. Auch zahlreiche, naturnah gestaltete und ökologisch gepflegte „Natur im Garten“ Schaugärten in Niederösterreich sind für Schmetterlingsbegeisterte das perfekte Ausflugsziel.
- Zeitig im Jahr fliegende Arten, wie der Zitronenfalter oder das Tagpfauenauge, suchen gerne Sal-Weide, Seidelbast oder Obstblüten auf und tanken Wärme an sonnigen Plätzen.
- Schmetterlinge bevorzugen Lebensräume mit abwechslungsreicher Struktur. Besonders viele Schmetterlingsarten finden sich auf blütenreichen Naturflächen mit z.B. Wiesen-Margerite, Glockenblumen, Flockenblumen, Wiesen-Salbei, Königskerze, Natternkopf, Echter Schafgarbe, Hornklee oder Kartäusernelke. Auch Disteln mögen Schmetterlingen gerne. Entlang von blütenreichen Hecken- oder Waldsäumen stehen die Chancen für Schmetterlingssichtungen ebenso gut. Falterarten, wie der Schwalbenschwanz versammeln sich zur Paarungszeit bevorzugt an Geländeerhebungen wie Hügelkuppen. Viele Nachtfalterarten werden, wie der Name schon sagt, erst ab der Dämmerung aktiv, um Nahrung an Pflanzen wie z.B. der Nachtkerze zu sammeln. Im Spätsommer saugen manche Arten wie der Admiral auch gerne an Fallobst.
- Besteht der Wunsch, eine ganz bestimmte Schmetterlingsart zu beobachten, sollten Sie vorab Informationen zu Flugzeit, bevorzugtem Lebensraum und ein wenig Kenntnis über die Nahrungspflanzen der Falter einholen.
- In der freien Natur, dem zu Hause unserer heimischen Pflanzen- und Tierwelt, steht das richtige Verhalten an vorderster Stelle: Blühwiesen sollten selbstverständlich nicht betreten und den Schmetterlingen nicht nachgestellt werden. In der Ruhe liegt die Kraft – Schmetterlingsbeobachtung ist eine gute Möglichkeit, Geduld und Achtsamkeit zu üben.
Im anlässlich des internationalen „Natur im Garten“ Tags (jährlich am 30. Juni) gestalteten Bestimmungsfolder, finden Sie eine Auswahl an heimischen Schmetterlingsarten zum näher Kennenlernen: www.naturimgarten.at/schmetterlingsbestimmungsfolder
Wenn Sie Ihre Beobachtungen mit einer schmetterlingsbegeisterten Community teilen möchten, ist die kostenlose Schmetterlingsapp der Stiftung Blühendes Österreich genau das Richtige für Sie: www.schmetterlingsapp.at

Die Sommerhitze hat uns voll im Griff. Kühles, frisches Nass ist da nicht nur bei uns Menschen und sämtlichen botanischen Schätzen im Garten höchst begehrt. Auch Insekten brauchen jetzt unbedingt Zugang zu Wasser. Bienen trinken gerne an Lacken, Schmetterlinge wie Tagpfauenauge oder Segelfalter nehmen auch gerne Feuchtigkeit und Salze von matschigen Böden auf. Wer keinen Platz oder die entsprechend gefüllte Börse für größere Wasserflächen im Garten hat, kann mit ganz einfachen Mitteln eine lebenspendende Gartenbar für unsere durstigen Bestäuber gestalten.
In einem Ton-Untersetzer, einer flachen Schale oder Vogeltränke werden ein paar größere Steine platziert, die immer noch halb aus dem eingefüllten Wasser ragen sollten. Von den Steinen aus gelangen die Insekten sicher an ihr Lebenselixier, ohne darin zu versinken. Auch mit Moos, Rinden- und Holzstücken kann die Wassertränke zugänglich gestaltet werden. Das Wasser sollte regelmäßig gewechselt und natürlich immer wieder nachgefüllt werden.
Ein größeres Gefäß – etwa ein Holzbottich, eine alte Badewanne oder ein verzinkter Metall-Zuber - bietet als Miniteich noch mehr Möglichkeiten und kann malerisch bepflanzt werden. Dafür wird etwa eine Handbreit lehmig-steinige Erde eingefüllt, die sich meist auch im eigenen Garten findet, und zwar in der Schicht unterhalb des humosen dunkleren Oberbodens. Dort hinein setzt man Sumpfpflanzen, die man mit Kies, Splitt, Schotter und/oder Steinen zusätzlich abdeckt oder befestigt: Kalmus zum Beispiel, eine wunderbare Duftpflanze, Zungenhahnenfuß und Tannenwedel, der für eine gute Wasserqualität sorgt oder der üppig blühende Blutweiderich in der Randzone. Dann befüllt man das Behältnis mit Regenwasser. Auch beim Miniteich darf eine Lande- und Ausstiegsbrücke nicht fehlen - nicht nur für Insekten, sondern auch für ins Wasser gefallene Kleintiere.
Die Miniwasserstellen eignen sich auch hervorragend, um die zahlreichen Bestäuber in unseren Gärten näher beobachten zu können und dadurch die Vielfalt unserer Natur kennen zu lernen. Insbesondere für Kinder sind solche Beobachtungs-Hotspots im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon perfekt, um die Natur aus nächster Nähe erleben zu können.

Wir alle können dazu beitragen, dass unsere Umgebung Lebensraum für Schmetterlinge ist und bleibt, z.B. indem wir unsere Gärten und Grünräume ökologisch pflegen und naturnah gestalten. Zudem gibt es eine tolle App, mit der jede und jeder helfen kann, wichtige Daten rund um unsere Schmetterlinge zu sammeln. Durch die wissenschaftliche Auswertung dieser Daten, erlangen wir mehr Kenntnis über Verbreitung, Vorkommen und Häufigkeit unserer Schmetterlinge. Dadurch können passende Schutzmaßnahmen für die jeweiligen Arten erarbeitet und umgesetzt werden. Bereits über 22.000 Freiwillige sind im Zeichen der Tagfalterzählung mit der Schmetterlings-App im Einsatz.
Viele gute Gründe also, um sich die Schmetterlings-App noch heute kostenlos auf www.schmetterlingsapp.at herunterzuladen und loszulegen! Die App zum Citizen Science Projekt „Schmetterlinge Österreichs“ steht kostenlos in den App-Stores von Apple und Android zur Verfügung. Auf www.schmetterlingsapp.at gibt es auch eine Desktopversion.

Umweltschutz und Artenschutz beginnt bei der richtigen Pflege und Gestaltung unserer Gärten und Grünräume. Gerade für Schmetterlinge gibt es wunderbare Möglichkeiten, um diese in öffentlichen Grünflächen zu fördern, ihnen Lebensraum zu bieten und den Fortbestand dieser bunten Gaukler zu sichern. In erster Linie ist es wichtig, auf chemisch-synthetische Pestizide zu verzichten. Aber Vorsicht, auch die Verwendung von biologischem Pflanzenschutzmittel kann den Tod für Falter und Co. bedeuten. Daher sind auch Bio-Pestizide mit Vorsicht zu verwenden. Daneben empfiehlt sich die Auswahl krankheitsresistenter Sorten und der Einsatz von Pflanzenstärkungsmittel.
Ein Potpourri aus naturnahen Wiesen, blühenden Staudenbeeten und der Einsatz heimischer Wildgehölze bei der Gestaltung öffentlicher Grünflächen können den Schmetterlingen einen strukturreichen Lebensraum bieten. Nähere Infos zur schmetterlingsfreundlichen Pflege und Gestaltung von Gärten und Grünräumen finden sich unter: www.naturimgarten.at/files/content/files/schmetterlinge.pdf

Schmetterlinge überwintern auf unterschiedliche Art und Weise: manche als Ei, andere als Raupe oder Puppe, oder sie suchen sich als erwachsenes Tier einen passenden Unterschlupf (Gartenhaus, Holzhaufen, Baumhöhlen, …). Es gibt jedoch auch Wanderfalter, die ähnlich wie Zugvögel in den Süden fliegen und Windströme für das Überfliegen des Meeres nutzen.
Ein beeindruckendes Beispiel unter ihnen ist der Distelfalter. Millionen Exemplare wandern ab Mitte Mai in Österreich und anderen Teilen Europas ein, um ihr Sommerquartier zu beziehen. Hier angekommen vermehren sie sich und das erwachsene Tier stirbt. Die junge Generation von Schmetterlingen zieht automatisch im Herbst nach Süden, vermehrt sich dort und stirbt. Deren Nachkommen wiederum zieht es weiter nach Afrika. Im Frühjahr geht dann die Reise über mehrere Generationen zurück nach Mitteleuropa. Insgesamt benötigt es bis zu sechs Generationen um diese Reise, hin und zurück über das Mittelmeer und die Sahara, zu meistern. Dabei ist der Wind der beste Helfer und so erreichen die Falter oft eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h. Bei ihren Wanderungen legen Schmetterlinge mit ihren zarten Flügeln über mehrere Generationen zusammengerechnet, tausende Kilometer zurück.
Neben dem Distelfalter, als einer der bekanntesten Wanderfalter, zählen in Österreich auch noch das Taubenschwänzchen, der Totenkopfschwärme und der Windenschwärmer zu den Faltern, die sich im Herbst auf weite Reise begeben.
Der kleine Fuchs wiederum, ist ein gutes Beispiel für einen Falter, der die wärmere Jahreszeit lieber in kühleren Regionen verbringt, zum Überwintern aber in wärmere Regionen oder Täler zieht.
Auch der Admiral galt als Wanderfalter, profitiert jedoch vom Klimawandel und den warmen Temperaturen des Winters. So überwintert dieser mittlerweile als erwachsenes Tier in geschützten Bereichen und muss die anstrengenden Wanderungen nicht mehr auf sich nehmen. Im Frühjahr können wir also künftig auch zunehmend Admirale beobachten.
Wenn du gerne wissen möchtest, welche Schmetterlinge du täglich im Garten oder beim Spazieren gehen beobachtest, solltest du die Schmetterlings-App nutzen. Die App zum Citizen Science Projekt „Schmetterlinge Österreichs“ steht kostenlos in den App-Stores von Apple und Android zur Verfügung. Auf www.schmetterlingsapp.at gibt es auch eine Desktopversion.

Duftende, würzende, heilende Kräuter gehören ganz nah an die Küche der NaturgärtnerInnen. Das Fensterbrett wird zum Kräutergärtchen – ein wenig Schnittlauch für die Suppe, ein paar Blätter Basilikum für den Salat … so beginnt oft die Begeisterung für den Nutzgarten. Kräuter sind einerseits für die Küche oder die Hausapotheke eine wunderbare Bereicherung, andererseits sind sie zusätzlich auch für Bienen, Hummeln, Schwebfliegen und Schmetterlinge ein unwiderstehlicher Anziehungspunkt als Nahrungsquelle.
Die Vielfalt der Kräuter lässt sich leicht im Garten oder im Topf kultivieren. Der richtige Boden ist für gutes Wachstum essenziell. Die unterschiedlichen Vorlieben der Kräuter, sowohl beim Standort als auch beim Substrat, sollten deshalb beachtet werden:
Locker, feucht, humos und nährstoffreich sollte es für Kräuter wie Petersilie, Melisse, Dill, Minze und Schnittlauch sein.
Durchlässige, trockene, magere und sandige Böden sind optimal für sonnenliebende Kräuter wie Lavendel, Rosmarin, Oregano, Thymian und Salbei.
Ein Kräuterbeet ist auch für heimische Insekten attraktiv. Mit ein paar ergänzenden Pflanzen wird es ein wahrer Besuchermagnet: z.B. mit Muskatellersalbei, Mauerpfeffer und Ringelblume.
Passend zum Kräuterbeet im Garten können auch Brennnesseln den Standort bereichern und dienen Tagpfauenauge, Admiral, C-Falter, Kleiner Fuchs, Landkärtchen und vielen mehr als Kinderstube für die Raupen – denn ohne Raupen gibt es auch keine Schmetterlinge.
Auf den Blättern von Petersilie, Dill oder Fenchel sind oft die Raupen vom Schwalbenschwanz zu finden, denn diese benötigen die Blätter von Korbblütlern. Die Raupen sitzen in der Regel einzeln auf den Pflanzen und richten im Gemüsebeet keinen Schaden an. Wenn sich die Raupe bedrängt fühlt, verteidigt sich durch das Ausstülpen einer geruchsverströmenden rotorangen Gabeldrüse (Osmaterium) aus ihrem Nacken. Die am Stängel der Futterpflanze befestigte Gürtelpuppe ist grün oder braun. Deshalb ist es wichtig, trockene Stängel bis in den Frühling ungeschnitten zu belassen. Wie die hübsche Raupe des Schwalbenschwanzes zeigt, können von wohlschmeckenden, gesunden Kräutern also nicht nur wir Menschen profitieren, sondern auch unsere Schmetterlinge.
Möchtest du genauer wissen, welche Schmetterlinge dein Kräuterbeet besuchen oder allen zeigen, wie viele Falter in deinem Garten herumflattern? Dann ist die Schmetterlings-App perfekt für dich! Die App zum Citizen Science Projekt „Schmetterlinge Österreichs“ steht kostenlos in den App-Stores von Apple und Android zur Verfügung. Auf www.schmetterlingsapp.at gibt es auch eine Desktopversion.

Ihr Balkonkisterl für die Artenvielfalt!
Der Erhalt unserer heimischen Artenvielfalt ist kein Trend oder Luxus, diese Vielfalt ist wichtig und unentbehrlich für den Menschen selbst. Allein das Insektensterben hat einschneidende Konsequenzen für die Zukunft des Menschen. Ohne die Leistung bestäubender Insekten, wäre mehr als ein Drittel der globalen Nahrungsmittelproduktion gar nicht möglich. Insektenfreundliches Gärtnern hat also durchwegs „egoistische Motive“, denn wer möchte schon in eine Zukunft ohne saftiges Obst und gesundes Gemüse blicken? Deshalb ist jeder m2 naturnah gestaltete Fläche wertvoller denn je - im Gemeindegrün ebenso wie im Privatgartenbereich oder in luftiger Höhe im Balkonkisterl. Balkonkisterl können durchwegs einen Beitrag zur Unterstützung unserer Insektenwelt leisten, wenn bei der Pflanzenauswahl sorgsam überlegt wird. Viele klassische Balkonblumen sind für unsere heimische Insektenwelt völlig ungeeignet. Die Auswahl an blühenden „Insektentankstellen“ für Balkon und Terrasse ist aber eigentlich sehr groß, viele insektenfreundliche Pflanzen, wie Kräuter, punkten zudem mit besonderer Hitzetoleranz und Pflegeleichtigkeit. Im Pflanzenreich gibt es anspruchslose Schönheiten, die wenig Wasser und keine oder nur geringe Düngung benötigen und ihre ganze Pracht besonders unter sonnigen, heißen Standortbedingungen entfalten. Diese Pflanzen erfreuen uns Naturgärtnerinnen und Naturgärtner aber nicht nur aufgrund ihrer Pflegeleichtigkeit. Einige beschenken uns mit einmaligen Blütenfarben und besonderem Blattschmuck. Viele krautige, mehrjährige Pflanzenarten kommen mit extremeren Bedingungen gut zurecht und bieten gleichzeitig einer großen Vielfalt an Schmetterlingen, Wildbienen & Co wertvolle Nahrung. So kann im Garten wie auch in luftiger Höhe am Balkon oder der Terrasse im Stadtgarten der Tisch für Schmetterlinge und andere heimische Blütenbesucher reich gedeckt werden.
Wer Schmetterlingen und summenden und brummenden Mitgeschöpfen etwas bieten möchte, sei herzlich eingeladen einmal etwas anderes, abseits der Mainstream Balkonbepflanzung, auszuprobieren. Bald wird Ihre Art der insektenfreundlichen Gestaltung zum Geheimtipp, denn nicht nur Ihre NachbarInnen, sondern auch die heimische Insektenwelt wird auf Ihr kleines, feines Gartenparadies fliegen.
Balkonblumen für Schmetterlinge
Scheinmyrthe (Cuphea hyssopifolia), Hängeverbene (Glandularia), Vanilleblume (Heliotropium arborescens), Wandelröschen (Lantana), Eisenkraut (Verbena).
Balkonblumen speziell für Nachtfalter
Ziertabak (Nicotiana), Nachtkerzen (Oenothera) und helle Petunien (Petunia)
Balkonblumen für zahlreiche Bestäuber
Sogenannte unspezifische Blumen können von Bienen, Faltern und anderen Insekten genutzt werden. Dazu zählen folgende Korbblütler:
Leberbalsam (Ageratum), Strauchmargerite (Argyranthemum), Dukatenblume/Goldtaler („Asteriscus“/Pallenis), Zweizahn/Goldmarie (Bidens), Blaugänseblümchen (Brachyscome), Dahlie (Dahlia), Kapringelblume (Dimorphotheca), Spanisches Gänseblümchen (Erigeron karvinskianus), Kapaster (Felicia), Mittagsgold (Gazania), Kapkörbchen (Osteospermum), Husarenknöpfchen (Sanvitalia), Studentenblume/Türkische Nelke (Tagetes), Strohblume (Xerochrysum/„Helichrysum“)
Wichtig ist, dass es sich um ungefüllte/einfache Sorten handelt. Neben Korbblütlern sind auch „Zauberschnee“ (Euphorbia-Hybriden) und Skabiosen (Scabiosa) für zahlreiche Bestäuber nutzbar.
Wie an der hier zusammengestellten Liste zu erkennen ist, gibt es reichlich Auswahlmöglichkeiten an schmetterlings- bzw. insektenfreundlichen Balkon- und Sommerblumen, wenn man die richtige Wahl trifft. Detaillierte Informationen zum Thema Balkonblumen für Bienen und Schmetterlinge finden Sie auch hier.

Ab April flattert das Landkärtchen, Insekt des Jahres 2023, wieder in unseren Gärten. Gestalten Sie deshalb Ihren Garten einladend für den fröhlichen Besuch des Landkärtchens sowie für die Vielfalt aller anderen heimischen Schmetterlingsarten. Jetzt im April, ist noch eine gute Zeit für die Anlage von Wildblumenwiesen, Blühstreifen oder blühenden Inseln im Garten. In unserer zunehmend ausgeräumten Kulturlandschaft ist jeder bunte Quadratmeter ein wertvoller Lebensraum. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und lassen Sie in Ihrem Garten eine Oase der Artenvielfalt erblühen. Unsere gaukelnden Schönheiten werden es Ihnen mit zahlreichem Besuch danken.
Bunte Vielfalt statt grüner Einfalt
Die Monokultur einer gleichmäßig grünen Rasenfläche ist, verglichen mit einer Wildblumenwiese oder einem Kräuterrasen, äußerst pflegeintensiv. In konventionellen Zierrasenflächen wachsen meist nur drei bis vier Grasarten, in einer Blumenwiese können hingegen bis zu 50 verschiedene Pflanzenarten vorkommen. Auf kleinem Raum ist hier also eine enorme biologische Vielfalt möglich.
Vorbereitung
Sonnige und magere Standorte, die selten betreten werden, sind ideal für die Anlage einer Wildblumenwiese. Große Blühflächen nehmen entsprechend Raum ein und sind nur eingeschränkt nutzbar, da Wildblumenwiesen am besten weitestgehend ungestört gedeihen. Wenn Sie eine größere Fläche anlegen möchten, können Sie dazwischen Wege und Sitzbereiche ausmähen, um die Pracht der Wiese zu genießen. Das jährlich anfallende Mähgut sollte nicht auf der Fläche verbleiben, sondern als Futter-Heu verwendet oder kompostiert werden. Berücksichtigen Sie derartige Aspekte bereits vorab bei der Wahl der Größe Ihrer Wildblumenwiese. Als kleinere, wertvolle Gestaltungselemente können im Randbereich des Gartens auch Blühstreifen oder blühende Inseln im Rasen angelegt werden. Wo bereits Rasen vorhanden ist, wird die Grasnarbe großzügig abgehoben und entfernt. Dann wird der Boden mit einem Grubber gelockert und Pflanzen-, Wurzelreste und größere Steine entfernt. Bei spärlich bewachsenen Flächen genügt es, die Erde nur zu harken, um einen feinkrümeligen, bewuchsfreien Untergrund zu erzielen. Auf nährstoffreichen, lehmigen Böden wird zudem eine drei Zentimeter hohe Schicht Bruchschotter oder Quarzsand aufgebracht, denn Wildblumen benötigen vor allem nährstoffarmes Substrat.
Aussaat
Beziehen Sie möglichst regionales Saatgut von spezialisierten Betrieben, denn gängiges Saatgut aus dem Handel beinhaltet meist nicht heimische und lediglich einjährige Pflanzenarten. Nur aus regionalem Saatgut erblüht jene Art von Wildblumenwiese, welche für die heimische Artenvielfalt so wertvoll ist. Mehrjährige Saatmischungen erfreuen uns zudem mit ihrem abwechslungsreichen Blütenreichtum über viele Jahre. Unser Fachteam vom „Natur im Garten“ Telefon unterstützt Sie unter +43 (0)2742/74 333 bzw. gartentelefon@naturimgarten.at gerne bei der Wahl geeigneten Saatguts sowie bei allen weiteren Fragen rund um das Thema Wildblumenwiese.
Mischen Sie das Saatgut (etwa 2-4 Gramm/m2) im Verhältnis 1:5 mit grobkörnigem Quarzsand oder Sägespänen und bringen Sie es breitwürfig per Hand aus. Für eine gleichmäßige Aussaat hat es sich bewährt, das Saatgemisch in zwei Teile aufzuteilen. Die eine Hälfte der Mischung wird quer, die andere Hälfte in Längsrichtung ausgesät. Drücken Sie die Samen dann mit einer Rasenwalze oder - in alter Gartenmanier - mit zwei unter die Füße geschnallten Brettern an, damit die Saat guten Kontakt mit dem Erdreich bekommt.
Unter www.youtube.com/@naturimgarten/playlists finden Sie in der Playlist „Gartentipps - schnell erklärt“ anschauliche Video-Anleitungen rund um das Thema Blumen- bzw. Blühwiesen sowie zahlreiche weitere Gartentipps rund um das ökologische Gärtnern.
Viel Freude beim Blumenwiesen säen und Schmetterlinge beobachten!

Straßenlaternen, Licht von Schaufenstern und Reklame, die Gebäudebeleuchtung und Lichtquellen in Parks und Gärten, machen die Nacht im Siedlungsraum zum Tag.
Diese „Lichtverschmutzung“ wirkt sich nicht nur ungünstig auf den Tag-Nacht-Rhythmus von uns Menschen aus, sie kostet auch unzähligen nachtaktiven Insekten wie Nachtfaltern das Leben. In Studien wurden an beleuchteten Standorten im Vergleich zu unbeleuchteten Flächen eine etwa um 25 % geringere Artenvielfalt und eine Reduktion der Bestäubungsleistung von über 60 % mit folglich 13 % weniger Früchten/Jahr festgestellt. Diese Zahlen zeigen deutlich, welchen großen und weitreichenden Einfluss Lichtverschmutzung auf die betroffene Umgebung hat.
Wie der Name Nachtfalter schon sagt, ist diese große Gruppe der Schmetterlinge hauptsächlich ab der Dämmerung aktiv, um Nahrung an Pflanzen wie z.B. der Nachtkerze zu sammeln. Nachtfalter spielen also eine wichtige Rolle als Bestäuber für nachtblühende Pflanzenarten. Als Nahrungsquelle für andere, stark gefährdete Tierarten wie Fledermäuse spielen sie zudem eine wesentliche Rolle im heimischen Ökosystem. Mit etwa 3.800 Arten machen die für uns weniger auffälligen Nachtfalter im Vergleich zu den etwa 200 Tagfalterarten den deutlich größeren Anteil der Schmetterlingsvielfalt Österreichs aus. Über 40 % der Nachtfalter gelten jedoch bereits als gefährdet. Ähnlich einem Dominoeffekt hat ihr Verschwinden empfindliche Auswirkungen auf viele weitere Pflanzen- und Tierarten. Einzelne Lichtquellen wirken in dunklen Bereichen aufgrund des stärkeren Kontrasts, wie z.B. Beleuchtung in unseren Gärten, besonders anziehend auf Insekten. Nachtfalter werden von solchen Leuchtelementen regelrecht in einen Bann gezogen, wo sie zu leichter Beute werden oder die Leuchtkörper die ganze Nacht bis zur Erschöpfung umschwirren. Durch den bedachten und klugen Einsatz von Leuchtmitteln im Garten und Grünraum können wir den Nachtfaltern aber sehr leicht schenken, was sie so dringend brauchen – Dunkelheit!

Smarter Umgang mit Licht im Garten
- Wo immer es möglich ist, gilt: Licht aus - das spart Energie wie Geld und außerdem lassen sich so auch Mond und Sterne viel besser genießen!
- Selbst kleine Solarlämpchen sind für nachtaktive Tiere aufgrund der Kontrastwirkung problematisch. Häufig werden Solarlampen unbedacht aufgestellt und leuchten die ganze Nacht als Dekorationsobjekt, wobei sie ungewollt Schaden verursachen ohne Nutzen zu bringen.
- Wer sich von liebgewonnenen Leuchtelementen nicht gänzlich trennen möchte, sollte sie im Bewusstsein der verursachenden Lichtverschmutzung möglichst wenig und nur bei tatsächlichem Aufenthalt nutzen.
Bewegungssensoren und Zeitschaltuhren sorgen für ausreichend Licht, wenn es tatsächlich benötigt wird. Zum Beispiel mit bewegungsabhängiger Beleuchtung, die ohne Bewegung auf etwa 20% zurückgeht und zu später Stunde nochmals abgesenkt wird.
Lichtquelle für Wegbeleuchtung niedrig installieren und gezielt auf den Boden richten, seitliche Abstrahlung möglichst geringhalten. Ein gutes Maß hierbei ist, wenn außer der beleuchteten Fläche kaum Lichtabstrahlung wahrgenommen werden kann.
Fassaden nicht flächig beleuchten, da helle Flächen das Licht stark reflektieren und so großräumige Lichtverschmutzung verursachen und stark anziehend auf Insekten wirken. - Lampen mit geschlossenem Gehäuse verwenden, damit sie nicht zur Insektenfalle werden.
- Bäume, Wasserflächen und andere Naturelemente sollten keinesfalls angestrahlt werden, denn sie sind das zu Hause von nacht- und tagaktiven Tieren.
- Besonders negativ wirken sich Leuchtmittel mit UV- und hohem Blauanteil im Emissionsspektrum sowohl auf uns Menschen als auch auf Nachtfalter aus.
- Aus Sicht von Medizin, Natur- und Umweltschutz wird deshalb empfohlen, warmweiße Leuchtmittel bis maximal 3.000 Kelvin Farbtemperatur mit möglichst geringem Blauanteil im Spektrum zu verwenden. Warmweißes bis gelbes Licht in einem Wellenlängenbereich zwischen 500 nm und 680 nm ist zu bevorzugen, doch Leuchtmittel die alle Bedingungen vollständig erfüllen, liegen derzeit nicht vor. Warmweiße LEDs mit einer Farbtemperatur bis 3.000 Kelvin (im Optimalfall mit Blaufilter) werden aufgrund ihrer hohen Effizienz und ihres Spektrums sowie der geringen Beeinträchtigung für Insekten als guter Kompromiss entsprechend des „Österreichischen Leitfadens Aussenbeleuchtung“ empfohlen. (Expertengruppe im Auftrag der Landesumweltreferenten Österreich, Österreichischer Leitfaden Aussenbeleuchtung 2018)
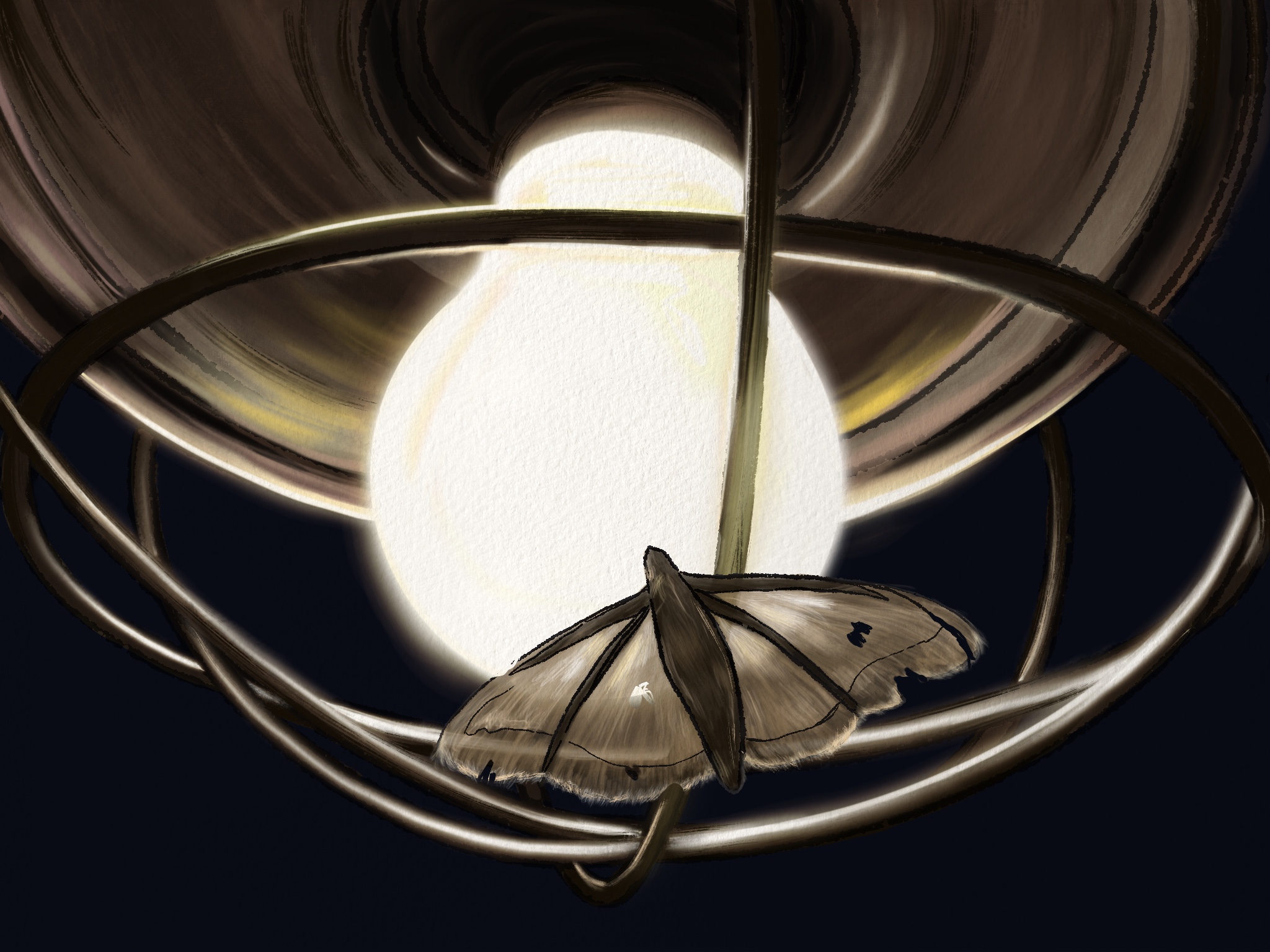
Wer sich selbst also etwas Gutes tun will und zugleich unsere nachtaktive Tierwelt schützen möchte, der sollte Licht im Garten äußerst sparsam und bedacht nutzen und den Mondscheingarten inklusiver Nachtmusik genießen, denn beides kann in unseren Zeiten mittlerweile als wahrer Luxus angesehen werden.


Mit über 4.000 Schmetterlingsarten (Tagfalter und Nachtfalter) zählt Österreich zu den artenreichsten Ländern - und ist damit ein sogenannter Hotspot - in Europa. Leider sind diese wunderbaren Geschöpfe auch stark gefährdet. Durch ökologische Pflege und naturnahe Gestaltung unserer privaten Gärten und öffentlichen Grünräume können wir den schönen Faltern und ihren Raupen Lebensraum und Nahrungsquelle bieten. Wir alle können also selbst wesentlich dazu beitragen, die Lebensbedingungen für Schmetterlinge zu verbessern und ihnen damit zu helfen! Was unsere zarten Juwelen und bunten Gaukler brauchen, hat „Natur im Garten“ in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Blühendes Österreich“ im Folgenden in sechs einfachen Punkten zusammengefasst. Punkt um Punkt lässt sich der Garten so in ein Paradies für Menschen, Schmetterlinge und viele weiter Gartentiere verwandeln.
1) Verzicht auf Pestizide!
2) Strukturreich gestalten
3) Futter für Raupen pflanzen
4) Nektarquellen für Schmetterlinge anbieten
5) Die richtige Pflege bringt's!
6) Licht abdrehen!
1. Verzicht auf Pestizide!
Ein tierfreundlicher Garten sollte unbedingt ökologisch gepflegt werden. Dies bedeutet, dass auf chemisch synthetische Pestizide gänzlich verzichtet wird. Die Breitenwirkung vieler eingesetzter (Insekten)gifte ist oft so groß, dass ungewollt auch Schmetterlinge und deren Raupen zu Schaden kommen. Zudem ernähren sich viele andere Tiere, wie etwa Gartenvögel, von Insekten. Durch den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden verlieren also auch zahlreiche weiter Gartentiere ihre Nahrungsgrundlage. Auch Bio-Pestizide sollten daher nur nach Ausschöpfen aller anderen Möglichkeiten, also nur im äußersten Notfall, und dabei gezielt und mit Bedacht eingesetzt werden. Gegen den Einsatz natürlicher Pflanzenstärkungsmittel, wie etwa Brühen, Jauchen oder Tees als vorbeugende Maßnahme, ist nichts einzuwenden.
2. Strukturreich gestalten – Mach den Garten zum lebendigen Mosaik
Schmetterlinge brauchen strukturreiche Gärten mit Naturhecken, Bäumen, sonnigen Kräuterrasen- oder Wiesenbereichen mit einer ganzjährigen Vielfalt an unterschiedlichen Wildblumen. Auch Wasserstellen und halbschattige/feuchte Bereiche, Wilde Ecken in denen Raupenfutterpflanzen wie die Brennnessel wachsen dürfen sowie Trockenbeete sind wesentliche Elemente in einem reich strukturierten Grünraum. In einem solchen Mosaik an Kleinlebensräumen fühlen sich unterschiedliche Schmetterlingsarten wohl. Dort sind ihre jeweiligen Bedürfnisse hinsichtlich Raupenfutter, Nektarquellen, Plätze zum Wärme tanken und Versteckmöglichkeiten erfüllt.
3. Futter für Raupen pflanzen
Schmetterlingsraupen haben gänzlich andere Bedürfnisse als die ausgewachsenen Tiere. Sie ernähren sich von Gräsern, Blättern oder Obst. Jede Schmetterlingsart hat ihre Vorlieben, sie ist also auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert. Der Zitronenfalter legt seine Eier z.B. nur auf Faulbaum und Kreuzdorn. Ohne diese beiden Gehölze gäbe es also keine Zitronenfalter. Geeignete Raupenfutterpflanzen für den Garten sind beispielsweise Brennnessel, Königskerze, Skabiose, Fenchel, Distelarten, Hornklee, Schlehdorn, Haselnuss, Brombeere, Weißdorn, Apfel und Zwetschke und viele mehr. Um Schmetterlingen zu helfen ist es also ebenso wichtig auch an die Bedürfnisse ihrer Raupen zu denken.
4. Nektarquellen für Schmetterlinge anbieten
Schmetterlinge ernähren sich ausschließlich von Nektar, welchen sie mir ihrem langen Rüssel aus Blüten schlürfen. Manche trinken zusätzlich den Saft von herabgefallenem, matschigem Obst und Wasser aus kleinen Lacken, um z.B. Mineralien aufzunehmen. Durch die bewusste Gestaltung von Staudenbeeten mit geeigneten Nahrungspflanzen können wir Schmetterlingen einen reich gedeckten Tisch im Garten bieten. Am besten blüht das Schmetterlingsparadies abwechslungsreich vom Frühjahr bis zum Herbst. Beispiele sind etwa Sonnenhut, Astern, Wilde Karde, Oregano, Seifenkraut, Lavendel, Natternkopf, Phlox, Liguster, Efeu und viele mehr.
5. Die richtige Pflege bringts!
Bereits länger bestehende Blumenwiesen sollten maximal zwei Mal im Jahr gemäht werden. Es ist wichtig, nie die ganze Fläche auf einmal zu mähen, sondern Teilbereiche ungeschnitten belassen. Alle zukünftigen Schmetterlinge, die sich dort noch in Form von Eiern, Raupen oder Puppen aufhalten, können nämlich nicht plötzlich „umsiedeln“ - sie würden sterben und sich nie zu Schmetterlingen entwickeln. Ob in breiten Streifen von fünf Metern auf großen Flächen, als ungemähter Randbereich der Wiese oder als Inseln im Rasen - Ziel des gestaffelten Mähens ist das Erreichen einer mosaikartigen und damit vielfältigen Struktur. Mut zu „Unordnung“ rettet Leben! Der Rückschnitt und die Pflege von Staudenbeeten sollte ebenso im späten Frühjahr erfolgen, damit an Pflanzenteilen ruhende Raupen und Puppen nicht bei der Überwinterung gestört werden. Der Boden braucht im Frühjahr nur oberflächlich gelockert werden, ein Umgraben tut dem Boden in der Regel nicht gut, denn es bringt das Bodenleben durcheinander. Manche Nachtfalter ruhen als Puppen im Boden. Finden sich solche Puppen bei der Bodenbearbeitung, sollten sie behutsam wieder in die Erde gelegt werden.
6. Licht abdrehen!
Ein großes Problem für Nachtfalter, die mit 3800 Arten den wesentlich größeren Anteil an Schmetterlingsarten in Österreich ausmachen, ist die vielerorts hohe Lichtverschmutzung. Die Falter werden vom Licht angezogen und regelrecht gebannt. Sie werden dort zu leichter Beute und umschwirren die Leuchtkörper bis zur Erschöpfung die ganze Nacht, anstatt zu fressen oder sich zu vermehren. Daher gilt im Garten: „Licht aus!“, wenn sich dort niemand aufhält. Bewegungssensoren können für Licht nach Bedarf sorgen. Auf kleine Solarlämpchen sollte ebenso verzichtet werden, auch sie sind in der dunklen Nacht für nachtaktive Tiere problematisch. In einem tier- und schmetterlingsfreundlichen Garten erfreuen wir uns an dunklen Nächten - denn ohne künstliches Licht können auch wir die Sterne und den Mond viel besser sehen und genießen!
Um Schmetterlinge im Garten bestimmen zu können, hier ein Tipp von uns: Die App zum Citizen Science Projekt „Schmetterlinge Österreichs“ steht kostenlos in den App-Stores von Apple und Android zur Verfügung. Auf www.schmetterlingsapp.at gibt es auch eine Desktopversion.

Über 4.000 Schmetterlingsarten gibt es in Österreich, deshalb zählt unser wunderbar vielfältiges Land, mit seinen Bergen, Tälern, Feldern und Wäldern sowie heißen pannonischen Regionen als Schmetterlings-Hotspot in Europa. Alarmierende Zahlen zeigen jedoch, dass unsere bunten Insektenjuwelen zunehmend schwinden. Derzeit gelten mehr als die Hälfte aller rund 200 Tagfalter Österreichs als gefährdet, 2 % sind sogar bereits ausgestorben! Auch bei den für uns weniger auffälligen etwa 3.800 Nachtfalterarten sind rund 40 % gefährdet und bereits 4% ausgestorben. Diese Zahlen stellen jüngst erhobene Durchschnittswerte dar, welche auch die Bestände in Naturschutzgebieten und somit in eigentlich besonders schmetterlingstauglichen Landschaftsgebieten miteinbeziehen. In der vom Menschen stark geprägten Kulturlandschaft ist die Gefährdungssituation vieler Arten noch wesentlich dramatischer. Wenn die Ursachen der Gefährdung unserer Schmetterlinge nicht rasch und umfassend behoben werden, könnte es darauf hinauslaufen, dass man Schmetterlinge zukünftig nur mehr in geschützten Gebieten oder gar nur mehr im Museum finden wird. Der große Artenverlust betrifft vor allem den Osten des Landes – und damit insbesondere auch Niederösterreich. Die stetige Zunahme ausgeräumter Landschaften, Pestizideinsatz und die Auswirkungen des Klimawandels, wodurch der Lebensraum alpiner Schmetterlinge schwindet, machen unseren Schmetterlingen zu schaffen.
Für unsere heimischen Nachtfalter gibt es aufgrund des Mangels an verfügbaren Daten sowie sich daraus ergebenden, dringend notwendigen Schutzmaßnahmen keine Gefährdungseinstufung (Rote Liste). Die Schätzungen zur Gefährdung einzelner Arten innerhalb dieser Gruppe basieren im Wesentlichen auf Schätzungen. In Wien, der Steiermark und dem Burgenland gelten trotz beachtlicher Artenvielfalt über 60 % der Falter als gefährdet. In Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Kärnten mit Anteilen an den Alpen sind derzeit auch außerhalb der Schutzgebiete großflächige naturnahe Lebensräume vorhanden. Die Ausarbeitung sowie Umsetzung effektiver Schutzmaßnahmen ist jedoch auch in diesen Bundesländern aufgrund fehlender Verbreitungsdaten sowie der daher nicht abschätzbare Gefährdungsstatus der jeweiligen Arten schwierig. Flächenversiegelung und Verbauung, intensive Forst und Landwirtschaft, Pestizideinsatz und nicht zuletzt die Klimaerwärmung – gerade in Gebirgslagen – setzen den Faltern stark zu. Neben der Zerstörung von Lebensräumen ist vor allem die Lichtverschmutzung für die Nachtfalter ein nicht zu vernachlässigendes Problem. Die große Artenvielfalt dieser Gruppe ist für uns Menschen wenig augenscheinlich, da viele von ihnen im Verborgenen leben oder unscheinbar sind. Im Gegensatz zu den bunten Tagfaltern dominieren bei den Faltern der Nacht Braun- und Grautöne. Je nach Art reicht die Größe von wenigen Millimetern bis zu mehreren Zentimetern. Das Wiener Nachtpfauenauge, unser größter heimischer Falter, ist mit einer Flügelspannweite von bis zu 16 cm (Handgroß!) hingegen ein wahrer Riese. Wie der Name schon sagt, sind Nachtfalter hauptsächlich ab der Dämmerung unterwegs, bestäuben in der Nacht blühende Pflanzen und dienen den ebenso stark gefährdeten Fledermäusen als wichtige Nahrungsquelle. Daher spielen Nachtfalter in mehrerlei Hinsicht eine wesentliche Rolle im heimischen Artengefüge, denn ihre Gefährdung wirkt sich gleich eines Dominoeffekts auf viele weitere Tierarten aus.
Nun, die wirklich gute Nachricht kommt jetzt zum Schluss! Wir alle können dazu beitragen, dass unsere Umgebung Lebensraum für Schmetterlinge ist und bleibt, z.B. indem wir unsere Gärten und Grünräume ökologisch pflegen und naturnah gestalten. Zudem gibt es eine sehr nützliche App, mit der jede und jeder helfen kann, wichtige Daten rund um unsere Schmetterlinge zu sammeln. Durch die wissenschaftliche Auswertung dieser Daten, erlangen wir mehr Kenntnis über Verbreitung, Vorkommen und Häufigkeit unserer Schmetterlinge. Dadurch können passende Schutzmaßnahmen für die jeweiligen Arten erarbeitet und umgesetzt werden. 2021 waren bereits über 22.000 Freiwillige im Zeichen der Tagfalterzählung mit der Schmetterlings-App im Einsatz.
Viele gute Gründe also, um sich die Schmetterlings-App noch heute kostenlos auf www.schmetterlingsapp.at herunterzuladen und loszulegen! Die App zum Citizen Science Projekt „Schmetterlinge Österreichs“ steht kostenlos in den App-Stores von Apple und Android zur Verfügung. Auf www.schmetterlingsapp.at gibt es auch eine Desktopversion.

Manche Schmetterlinge wie Distelfalter, Postillon und Taubenschwänzchen werden auch Wanderfalter genannt, denn diese machen sich rechtzeitig vor dem Winter in den wärmeren Süden auf und kehren erst in Form ihrer Nachkommen im Frühsommer wieder zurück. Zahlreiche andere Schmetterlingsarten wie Aurorafalter und Schwalbenschwanz, Schachbrettfalter oder Apollofalter überdauern in unseren Breiten in Form unterschiedlicher Entwicklungsstadien (50 % als Puppe, 44 % als Raupe und 5 % als Ei), um den Winter erfolgreich zu überstehen. Lediglich eine geringe Anzahl an Arten (1 %) überwintert als Falter und erfreut uns, wenn sie schon zeitig im Jahr als erste Frühlingsboten durch unsere Gärten flattern. Besonders bemerkenswert unter ihnen ist der Zitronenfalter, denn er ist mit einer Kältetoleranz von bis zu -20 °C ein wahrer Meister des Frostschutzes. Er lässt sich als meist erste Schmetterlingsart an sonnigen Tagen im Frühjahr in der Regel schon im März beobachten.
Zitronenfalter haben mit einer Lebensdauer von bis zu 12 Monaten die höchste Lebenserwartung aller mitteleuropäischen Schmetterlinge. Als Falter überwintern sie gut getarnt ähnlich einem verdorrten Blatt in der Vegetation hängend, wobei sie geschützte Plätze unter Immergrünen, vor allem Efeu, durchaus bevorzugen. Schnee oder Eis macht ihnen nur wenig aus, da die Zitronenfalter ein ausgeklügeltes Frostschutzsystem nutzen. Zum einen reduzieren sie vor dem Winter Körperflüssigkeit, zum anderen sind sie durch ihr körpereigenes Frostschutzmittel (Glycerin) geschützt, wodurch ihre verbleibende Köperflüssigkeit nicht gefriert. Nach dem Frühlingserwachen suchen sie gerne Seidelbast, Sal-Weide, Dirndlstrauch und Primeln auf, um Nektar zu saugen. So erfreuen sie uns schon zeitig im Frühling mit ihrem erfrischenden Farbton – intensiv zitronengelb die Männchen, blass grünlich-weiß die Weibchen. Leider kommt es mittlerweile durch die milderen Winter immer wieder vor, dass Zitronenfalter an sonnig-warmen Tagen im Jänner oder Februar aus ihrer Winterstarre erwachen und von uns Menschen erfreut beobachtet werden. Für die Falter selbst bedeutet dies in der Regel jedoch wenig Gutes, da wertvolle Energie verbraucht wird und es zu dieser Jahreszeit so gut wie keine Nahrung gibt. Dadurch könnte es für die Zitronenfalter in Zukunft schwerer werden, hierzulande gut über den Winter zu kommen. Abhilfe können nektarreiche Winterblüher wie etwa Winter-Heckenkirsche oder Winterduftschneeball schaffen, damit wir dem Zitronenfalter einen guten Start ins neue Jahr ermöglichen.

„Natur im Garten“ ist eine vom Land Niederösterreich getragene Bewegung, welche die Ökologisierung von Gärten und Grünräumen in Niederösterreich und über die Landesgrenzen hinaus vorantreibt. Die Kernkriterien der Bewegung „Natur im Garten“ legen fest, dass Gärten und Grünräume ohne chemisch-synthetische Pestizide und Dünger und ohne Torf gestaltet und gepflegt werden. „Natur im Garten“ bietet unterschiedliche Angebote für private Hobbygärtnerinnen- und Gärtner genauso wie für Gemeinden, Profigärtnerinnen und -gärtner sowie Pädagoginnen und Pädagogen.
Spannende Themen warten bei unseren kostenlosen Webinaren auf Sie. Das „Natur im Garten“ Telefon: +43 (0) 2742 / 74 333 steht Ihnen für Gartenfragen zur Verfügung.
Unsere „Natur im Garten“ Partnerbetriebe bieten Ihnen eine große Brandbreite an Services und Produkten rund um das Thema Garten an. Bei unseren Gütesiegel-Partnern können Sie außerdem ökologische Gartenprodukte kaufen.
Bleiben Sie mit dem „Natur im Garten“ Newsletter, dem „Natur im Garten“ Magazin sowie als Facebook-, Instagram- oder YouTube-Fan immer up to date!



